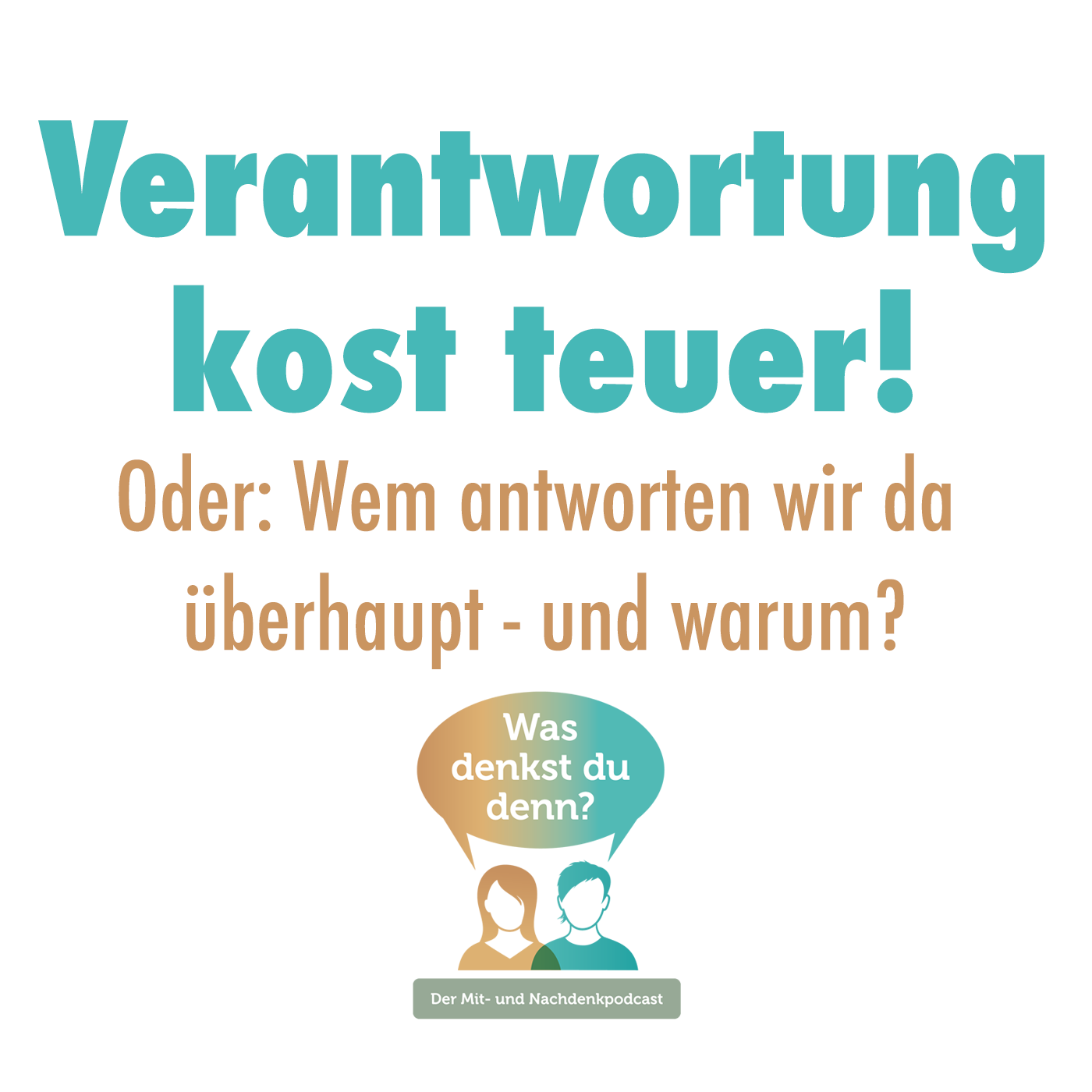dies ist eine Seite für
Browsing Tag: Patriarchat
„Sprache schafft Realität“ – ein viel bemühter Satz. Aber stimmt er auch? Denn eigentlich bildet Sprache zunächst eher Wahrnehmung ab. Wir formulieren mit ihr auch eine Realität, die wir uns wünschen. Wir entwerfen uns mit ihr. Aber damit daraus Konsens wird, eine allgemeingültige oder zumindest mehrheitsgültige Realität, muss einiges mehr passieren.
Und dann ist da ja auch noch der Umstand, dass wir nicht nur sprechend kommunizieren. Sondern auch in Gesten zum Beispiel. Oder in Räumen. Und dass nicht nur das Codieren zum Akt der Kommunikation gehört, sondern auch das de-codieren. Das heißt: Wir müssen auf vielfältige Arten lesen können – und das können wir – um zu verstehen. Aber wie immer sind all diese Prozesse störanfällig – und spätestens da fängt dann das Zappeln an.
Ritas Literaturliste:
- Das Ende des „linguistic turn“? Stellungnahmen von Wolfgang Barz, Thomas Grundmann, Albert Newen und Christian Nimtz. In: Information Philosophie 1/2017. Abrufbar unter: https://philosophie.uni-koeln.de/sites/cssip/Publikationen/DasEndedeslingusticturn.pdf (Datum des letzten Abrufs: 16.04.2021)
- Endler, Rebekka: Das Patriarchat der Dinge. Warum die Welt Frauen nicht passt. Köln 2021.
- Funke, Joachim: Sprache und Denken: Einerlei oder Zweierlei? Einige Überlegungen aus Sicht der Psychologie. Interdisziplinäres Forum – Ringvorlesung Wintersemester 1999/2000 „Sprache und Denken“. Gefördert von der Studienstiftung des Deutschen Volkes und der Universität Heidelberg. Vortrag gehalten am 18.11.1999. Abrufbar unter: https://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/mitarb/jf/Funke1999Sprache&Denken.pdf (Datum des letzten Abrufs: 17.04.2021)
- Hülsse, Rainer: Sprache ist mehr als Argumentation. Zur wirklichkeitskonstituierenden Rolle von Metaphern. In: Zeitschrift für Internationale Beziehungen. 10. Jahrgang, Heft 2/2003. S. 211-246.
- Koller, Hans-Christoph: „Alles Verstehen ist daher immer zugleich ein Nicht-Verstehen“. Wilhelm von Humboldts Beitrag zur Hermeneutik und seine Bedeutung für eine Theorie interkultureller Bildung. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 6/2003, S. 515–531.
- Gümüşay, Kübra: Sprache und Sein. Wie Sprache unser Denken prägt und unsere Politik bestimmt. Berlin 2020.
- Nietzsche, Friedrich: Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn. KSA Band 3. München, Berlin, New York 1999.
- Wittgenstein, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus. Werkausgabe, Band 1. Frankfurt/Main 1984. [Orig. 1921]
- Danger Dan: Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. 2021. Abrufbar unter https://youtu.be/Y-B0lXnierw (Datum des letzten Abrufs 18.04.2021) ZDF Magazin Royale, Talk Igor Levit und Danger Dan: Wer oder was ist von der Kunstfreiheit gedeckt? https://youtu.be/8FXQOVnp8lk (Datum des letzten Abrufs 17.04.2021)
Noras Linkliste:
- Symbolpolitik unterm Regenbogen – Homophobie im Fußball, Sport Inside Podcast vom 03.04.2021 abgerufen unter https://audiothek.ardmediathek.de/items/87805104 (Datum des letzten Abrufs 22.04.2021)
- „Ich kann machen, was ich will in meinem eigenen Projekt.„, Gespräch mit der Buchautorin und Journalistin Rebekka Endler. Mensch, Frau Nora! Podcast vom 17.04.2021 abgerufen unter: https://mensch-frau-nora.de/rebekka-endler-das-patriarchat-der-dinge/ (Datum des letzten Abrufs 22.04.2021)

Zwei Künstler:innen – Moshtari Hilal und Sinthujan Varatharajah – sprechen in einem insta-Live über Nazierbe und prägen dabei den Begriff „Mensch mit Nazihintergrund“. Sie erzwingen damit einen Perspektivwechsel und verweisen auf eine Verantwortung handelnder Personen, wenn es um die Familiengeschichte im NS geht. Ein spannender Aspekt, diese Verantwortung. Denn es stellt sich natürlich auch die Frage: Was verantworten wir da eigentlich, vor wem, warum? Und können Tiere das eigentlich auch, sich verantworten?
Und überhaupt, warum wiegt Verantwortung so schwer? Und warum entlohnen wir diejenigen, die bestimmte Verantwortungen tragen, so fürstlich? Wir landen nicht nur beim Patriarchat und dem Oikos, sondern auch bei den alten Römern, in einer „Life of Brian“-Schleife – und in Sekunden der Sprachlosigkeit. Denn Rita hat, was die Verantwortungsfrage angeht, einen regelrechten Plottwist mitgebracht!
Ritas Literaturliste:
- Apel, Karl-Otto: Diskurs und Verantwortung. Das Problem des Übergangs zur postmodernen Moral. Frankfurt/Main 1990.
- Birnbacher, Dieter: Verantwortung für zukünftige Generationen. Stuttgart 1988.
- Bloch, Ernst: Das Prinzip Hoffnung. 3 Bände. Frankfurt/Main 1980. [1938-1947]
- Jonas, Hans: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt/Main 1984. [1979]
- Jonas, Hans: Dem bösen Ende näher. Gespräche über das Verhältnis des Menschen zur Natur. Frankfurt/Main 1993, S. 57
- Weber, Max: Politik als Beruf. Stuttgart 1992. [1919]
- Weischedel, Wolfgang: Das Wesen der Verantwortung. Ein Versuch. Frankfurt/Main 1974.
- Wetz, Franz Josef: Hans Jonas. Eine Einführung. Wiesbaden 1994.
Noras Linkliste:
- Nazierbe – Das Gespräch zwischen Moshtari Hilal und Sinthujan Varatharajah bei instagram (Gesendet 15.02.2021)
- K-Pop-Band BTS: Empörung über Bayern-3-Moderator – Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom 26.02.2021
- Tagebau 3-D-Projekt des WDR – Verantwortung und Natur