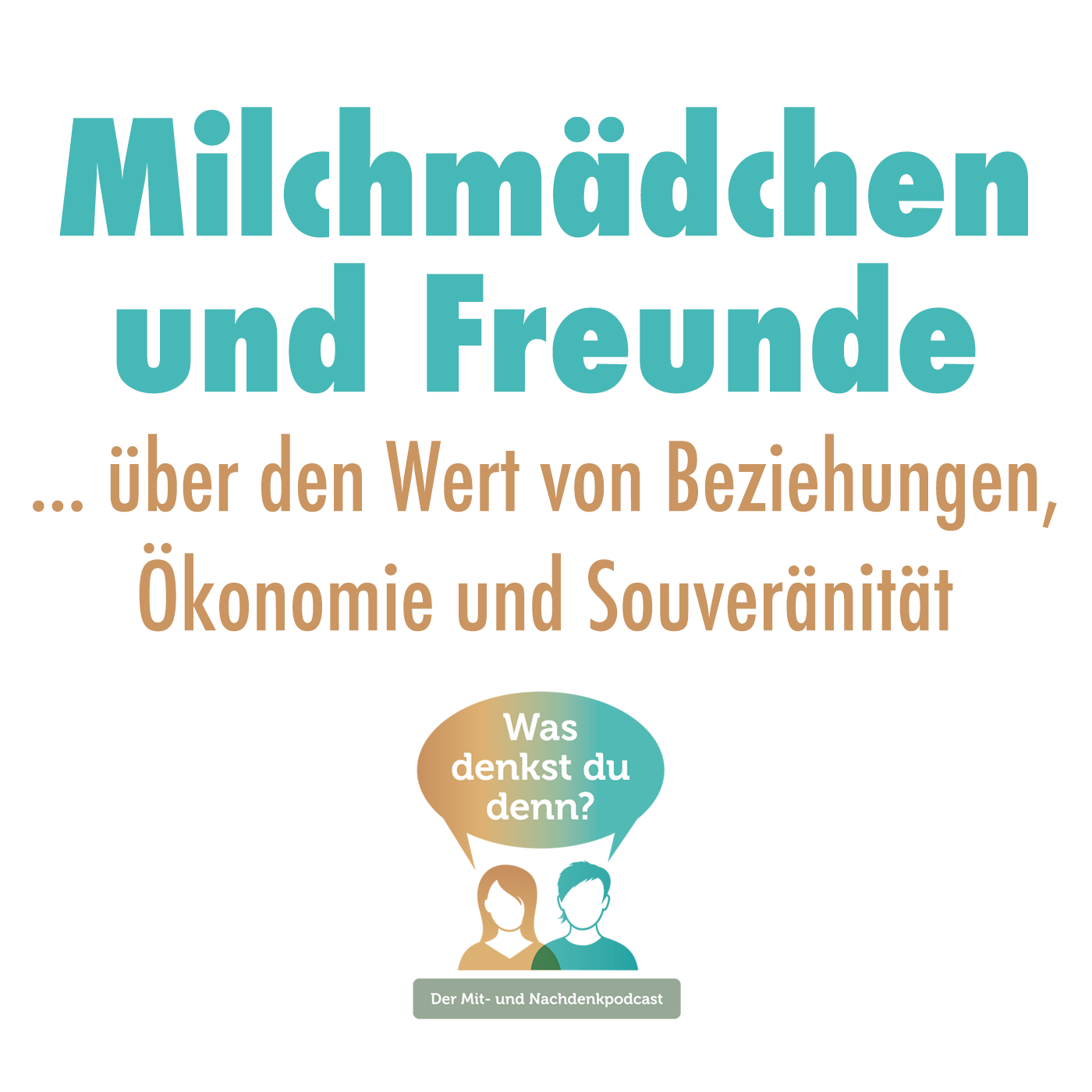dies ist eine Seite für
Browsing Tag: Beziehungen
Wir leisten Beziehungsarbeit, investieren in Freundschaften, machen Abstriche für Partner:innen, und am Ende des Tage fragen wir uns, ob sich das alles gelohnt hat. Wenn wir über Beziehungen sprechen, nutzen wir häufig ökonomisches Vokabular. Warum eigentlich?
Was kostet es eigentlich, so einen Podcast zu machen? Was investieren Rita und Nora in dieses Projekt? Ganz ehrlich: So richtig lässt sich das nicht beziffern, selbst dann, wenn wir versuchen würden, all das, was in diesem Podcast steckt, zu quantifizieren. Und trotzdem können wir uns auch nicht so ganz lösen von ökonomischen Bezügen und Beziehungen. Überhaupt ist uns das Vokabular der Ökonomie so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir es auch da nutzen, wo uns eigentliche andere Werte wichtiger sein sollten – und vielleicht auch sind. Aber wir können sie eben nicht so leicht benennen. Wie unsere Beziehungen aussehen, warum wir die Ökonomie da nicht – haha – rausrechnen können, und warum wir Souveränität brauchen in Beziehungen, darum geht’s in dieser Ausgabe von „Was denkst du denn?“.
Ritas Literaturliste
- Bergmann, Jens: Der Preis der Liebe. In: Brandeins. 2000. Abrufbar unter https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2000/design/der-preis-der-liebe (Datum des letzten Abrufs: 05.02.2021)
- Böhme, Gernot: Ethik leiblicher Existenz. Frankfurt/Main 2008, S. 188 – 201 (Kap. „Souveränität und die Ethik des Pathischen“)
- Houellebecq, Michel: Ausweitung der Kampfzone. Reinbek bei Hamburg 2000.
- Illouz, Eva: Der Konsum der Romantik. Frankfurt/Main 2007.
- Kuchler, Barbara/ Beher, Stefan: Soziologie der Liebe. Romantische Beziehungen in theoretischer Perspektive. Frankfurt/Main 2014.

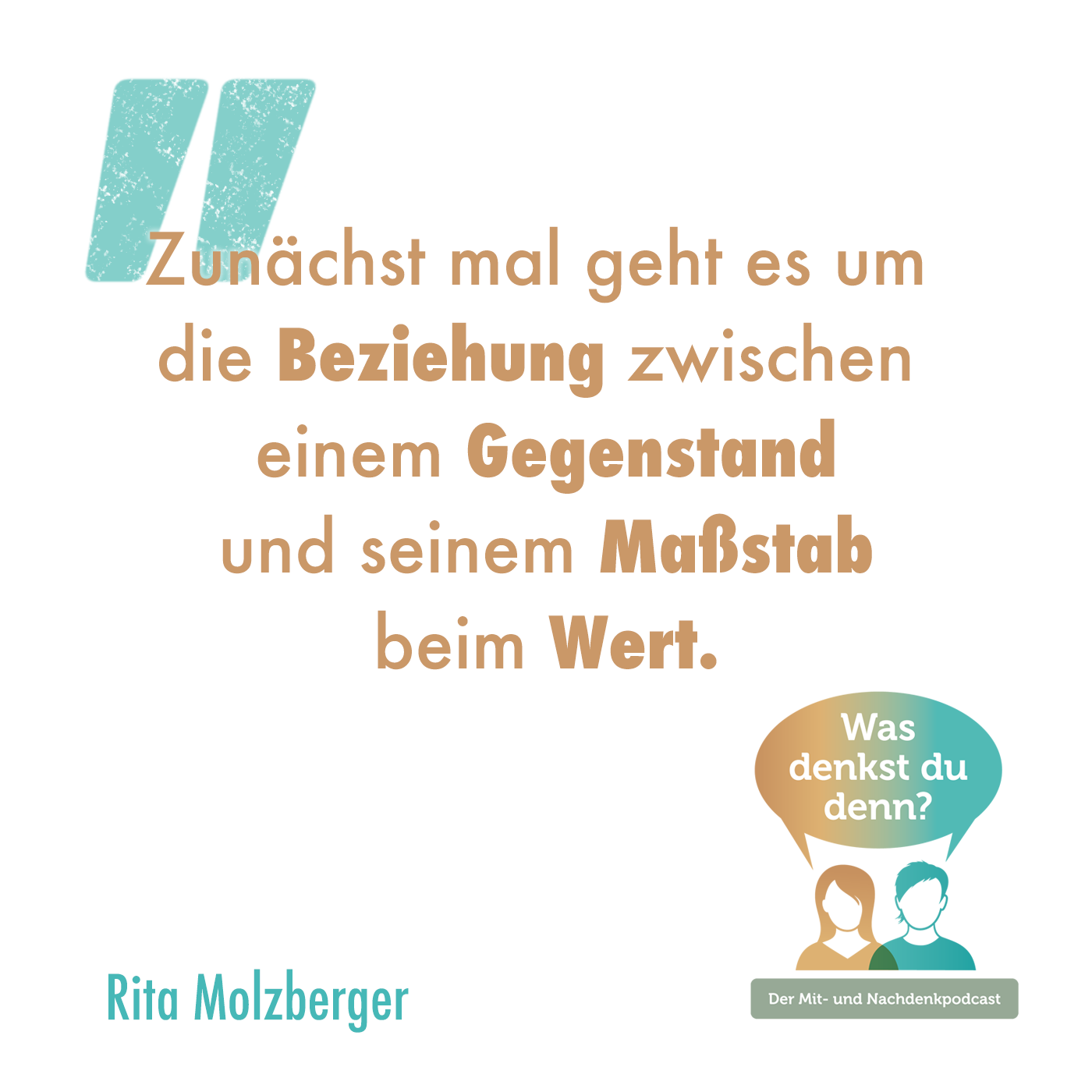
Wir haben Hörerpost bekommen – und eine Frage dazu: Was sind eigentlich Werte? Wie definieren wir die? Sehr gute Frage! Und eine von Ritas schlauen Antworten: „Wert ist ein Beziehungsbegriff, weil Menschen Werte zuweisen“. Dafür benutzen wir Maßstäbe. Zum Beispiel bei einem Wert wie Wahrheit. Wie wahr ist etwas? Oder für wie wahr halten wir etwas? Und ist das Wahrere dann auch das Bessere? Schließlich kann Wahrheit manchmal ganz schön unangenehm sein. Und was ist eigentlich mit sowas wie Pünktlichkeit? Wir sagen ja: „Ich lege Wert auf Pünktlichkeit“, aber ist damit Pünktlichkeit schon ein Wert an sich? Und was passiert mit einem Wert eigentlich, wenn ihn niemand mehr beachtet oder wenn wir ihn als hinderlich für die Gesellschaft verwerfen? Gibt es den viel beklagten Werteverfall wirklich? Oder findet eher ein Wertewandel statt? Ihr seht schon: Viele Fragen, die sich da auftun – und die Rita und Nora versuchen für euch ein bisschen zu klären.
Ritas Literaturliste:
- Gorz, André: Wissen, Wert und Kapital. Zur Kritik der Wissensökonomie. Zürich 2004.
- Gray, John: Raubtier Mensch. Die Illusion des Fortschritts. Stuttgart 2015.
- Greenblatt, Stephen: Die Wende. Wie die Renaissance begann. München 2012.
- Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Werke, Band 1. Berlin 1966. [Original: 1867 ff.]
- Nietzsche, Friedrich: Menschliches, Allzumenschlisches. Ein Buch für freie Geister. Zweiter Band. Verlag von E. W. Fritzsch. Leipzig 1886. Abgerufen unter nietzschesource.org am 17.08.2018
- Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst: Vorlesung über Pädagogik. In: Winkler, Michael/ Brachmann, Jens (Hrsg.): Texte zur Pädagogik, Band 2. Frankfurt/Main 2000.
- Zweig, Stefan: Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam. Belrin 1981. [Original: 1934]