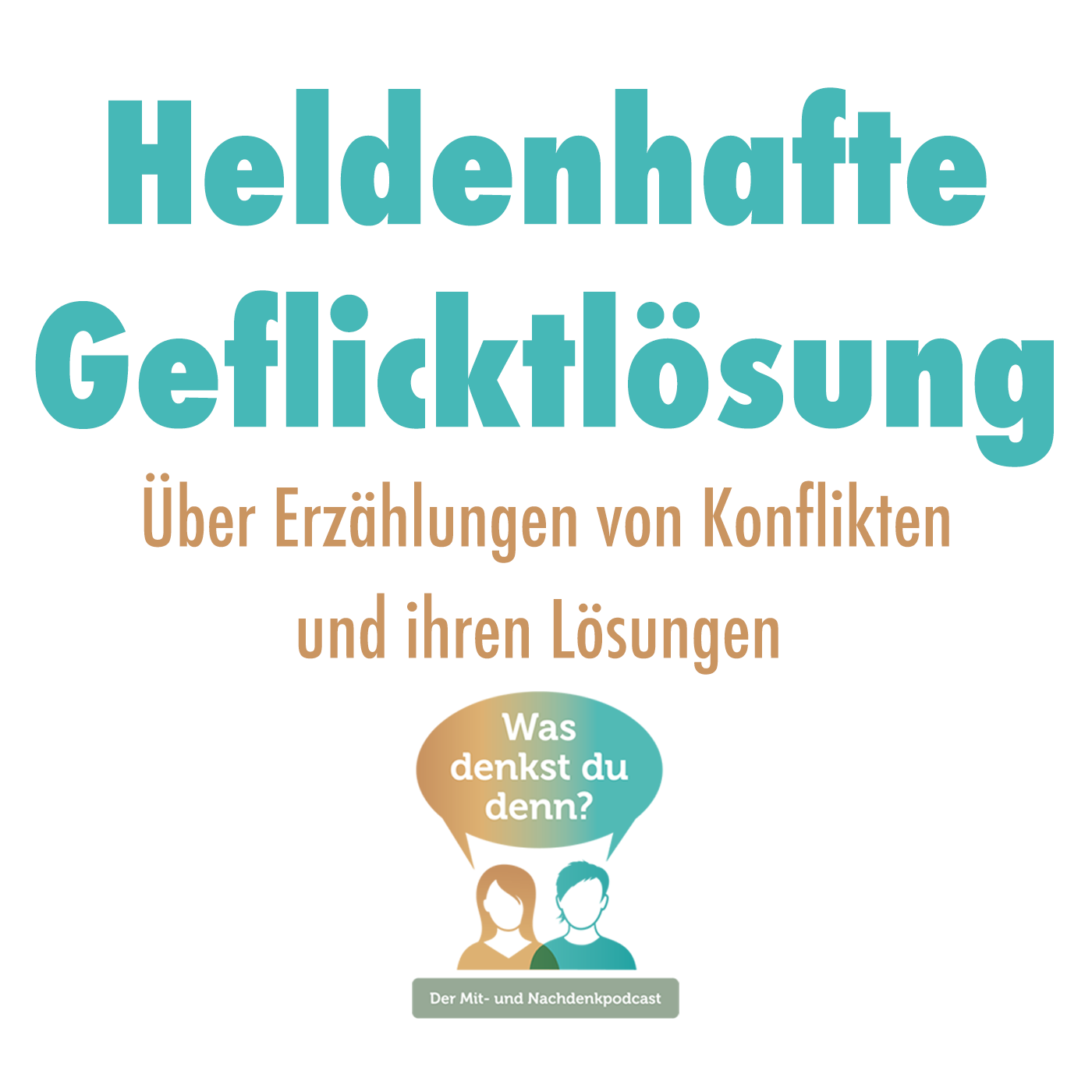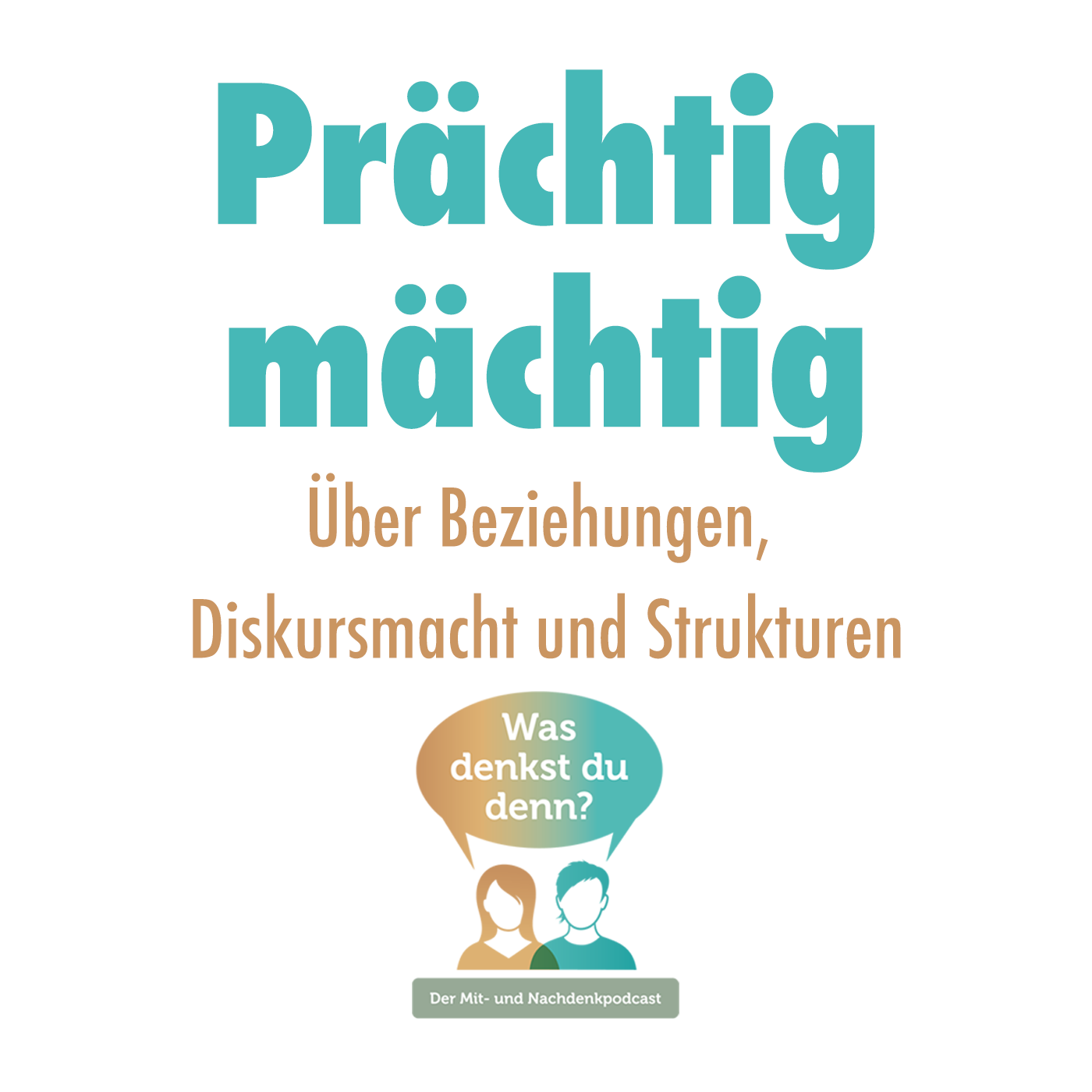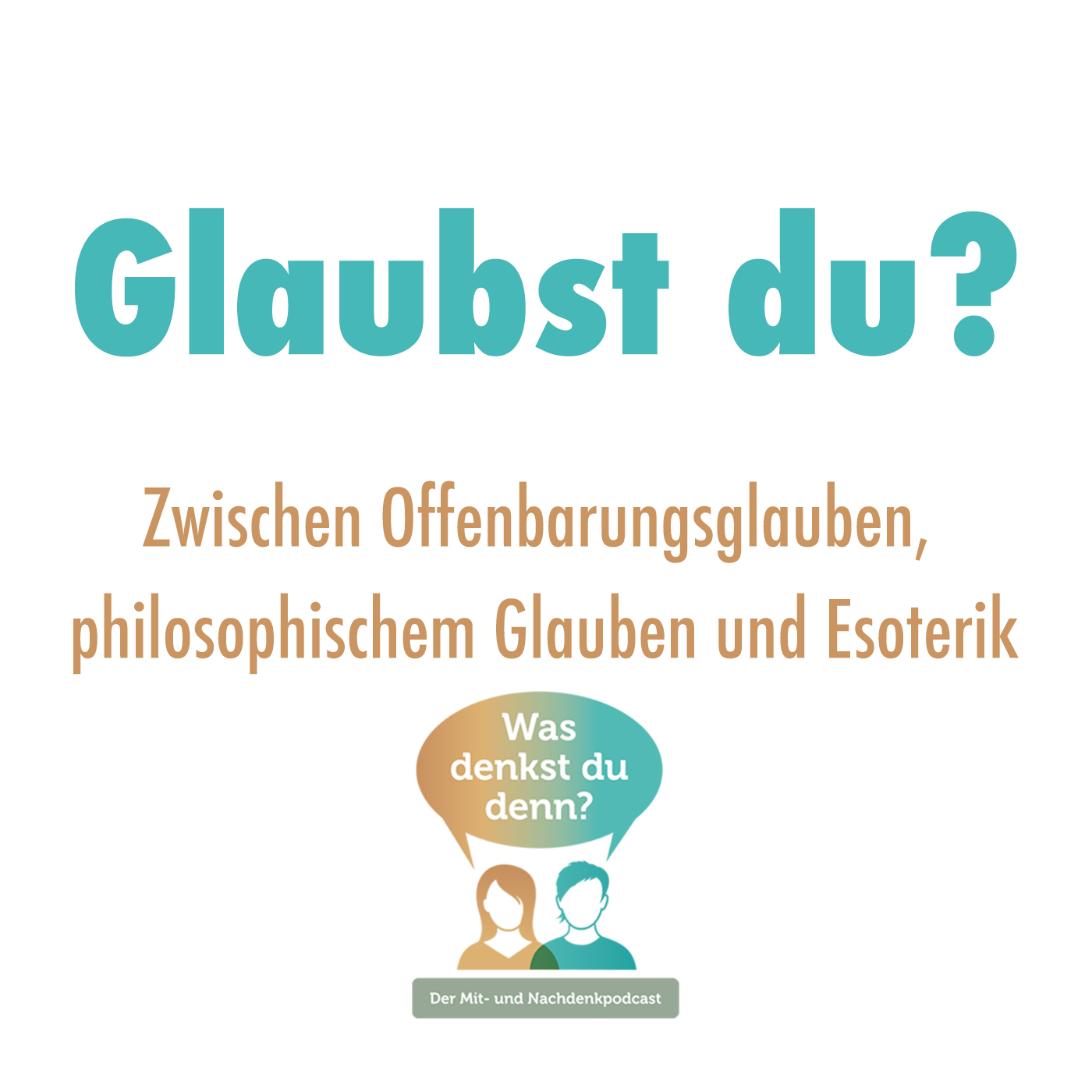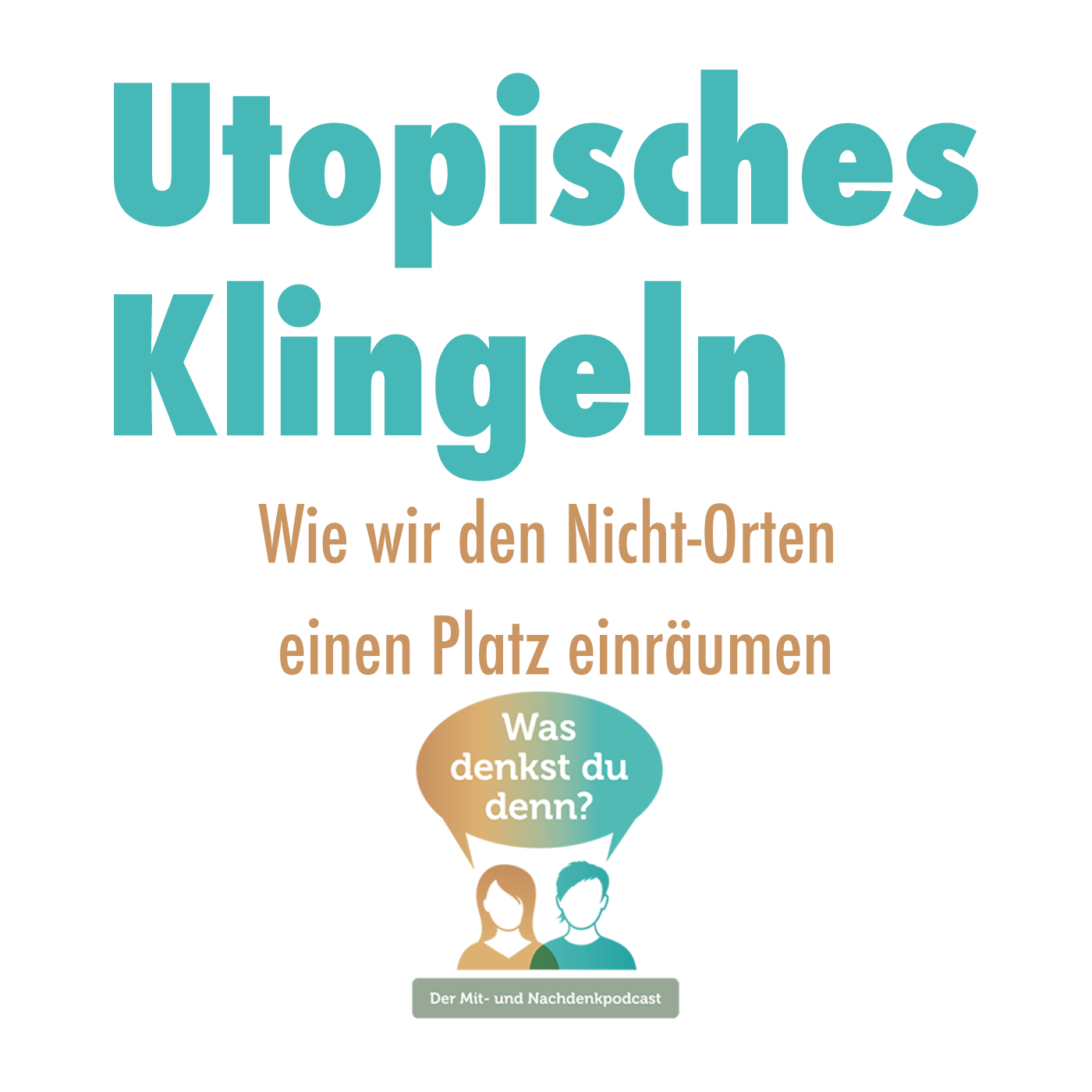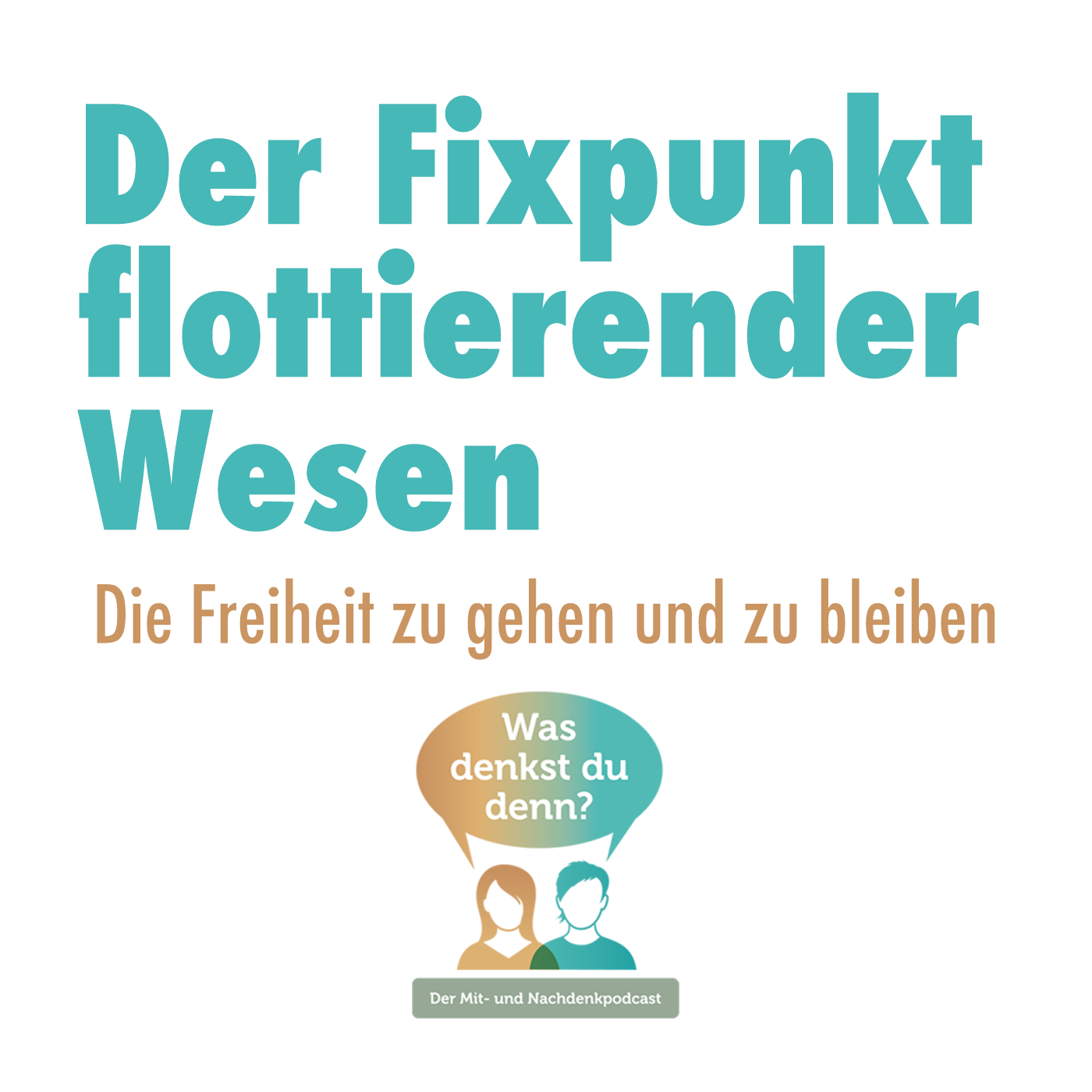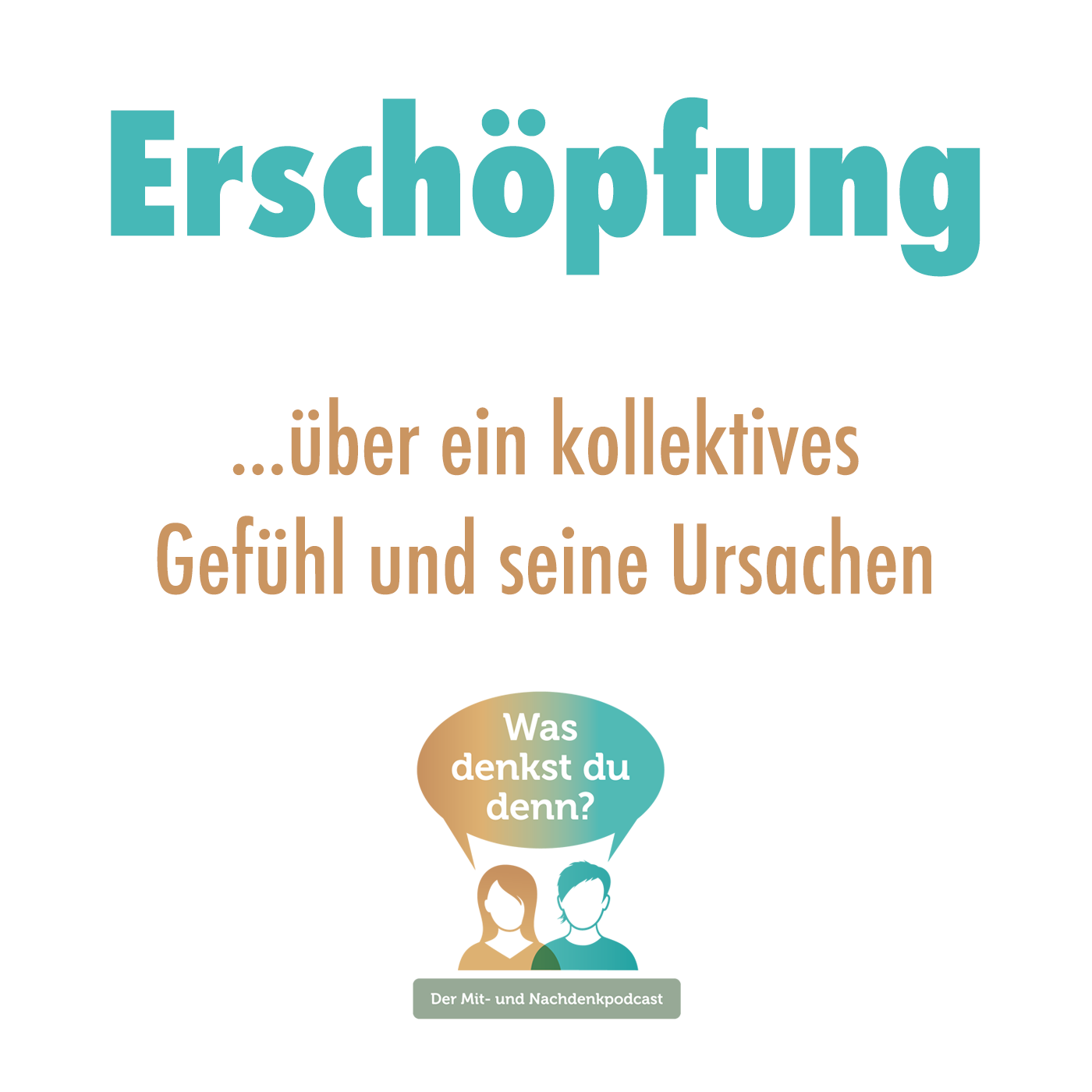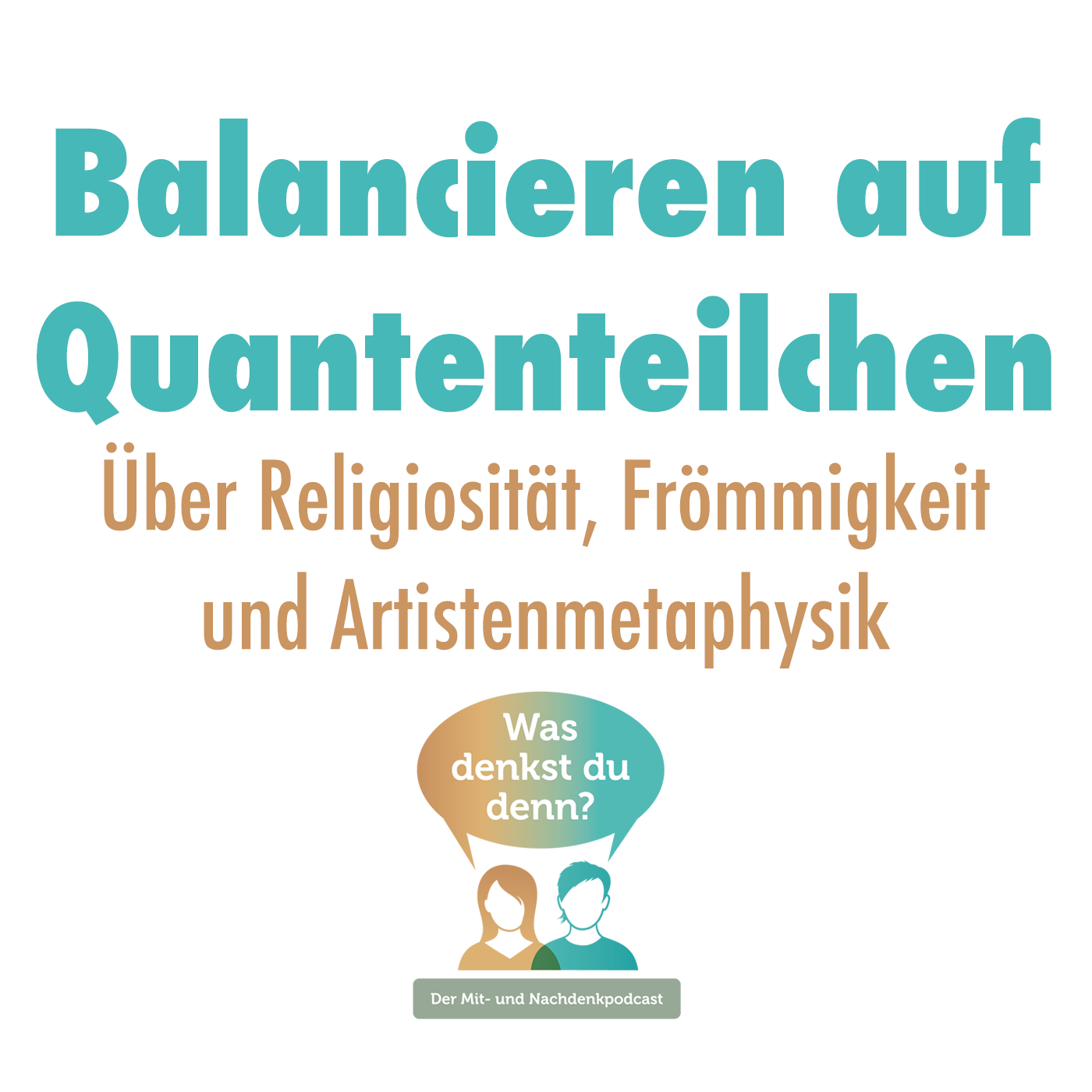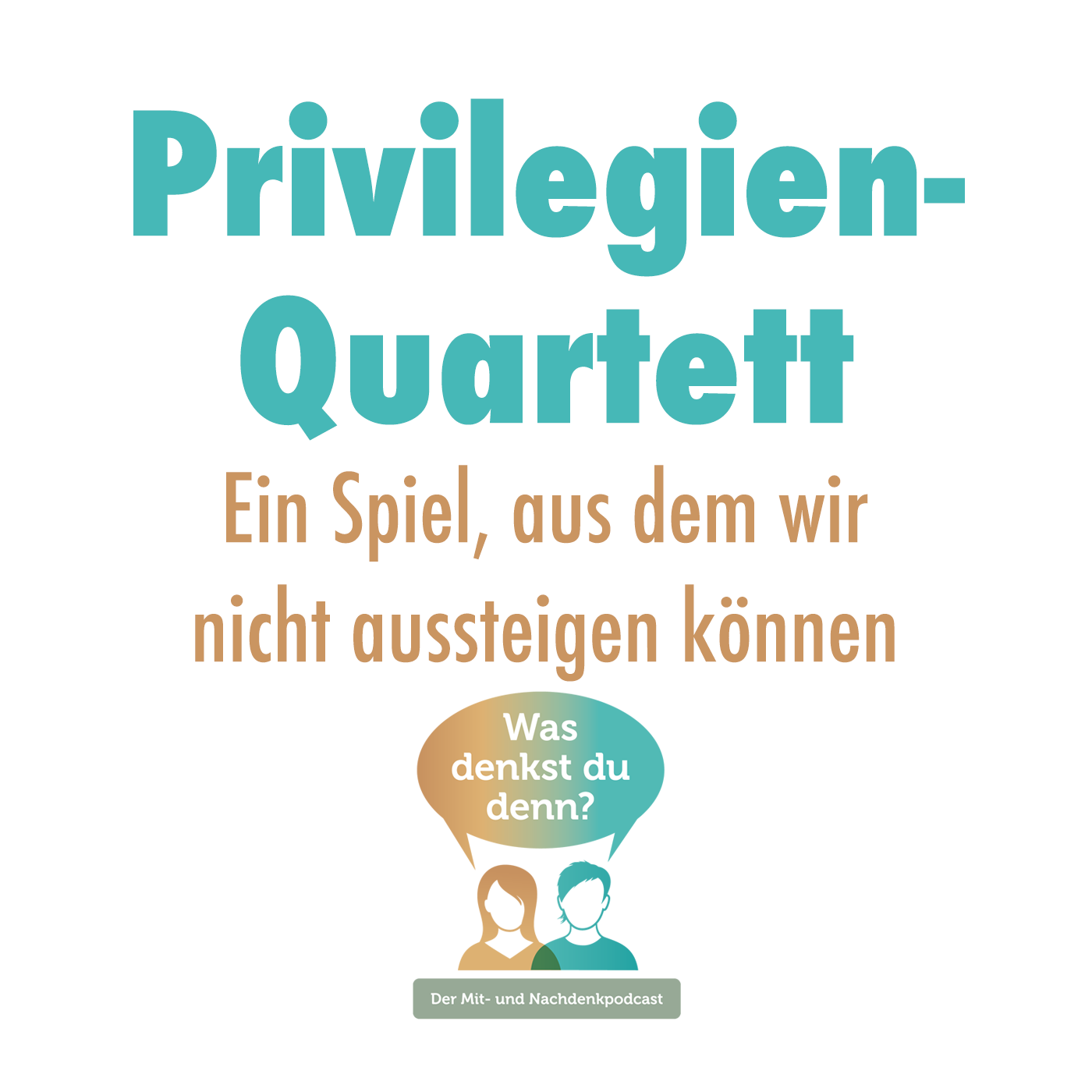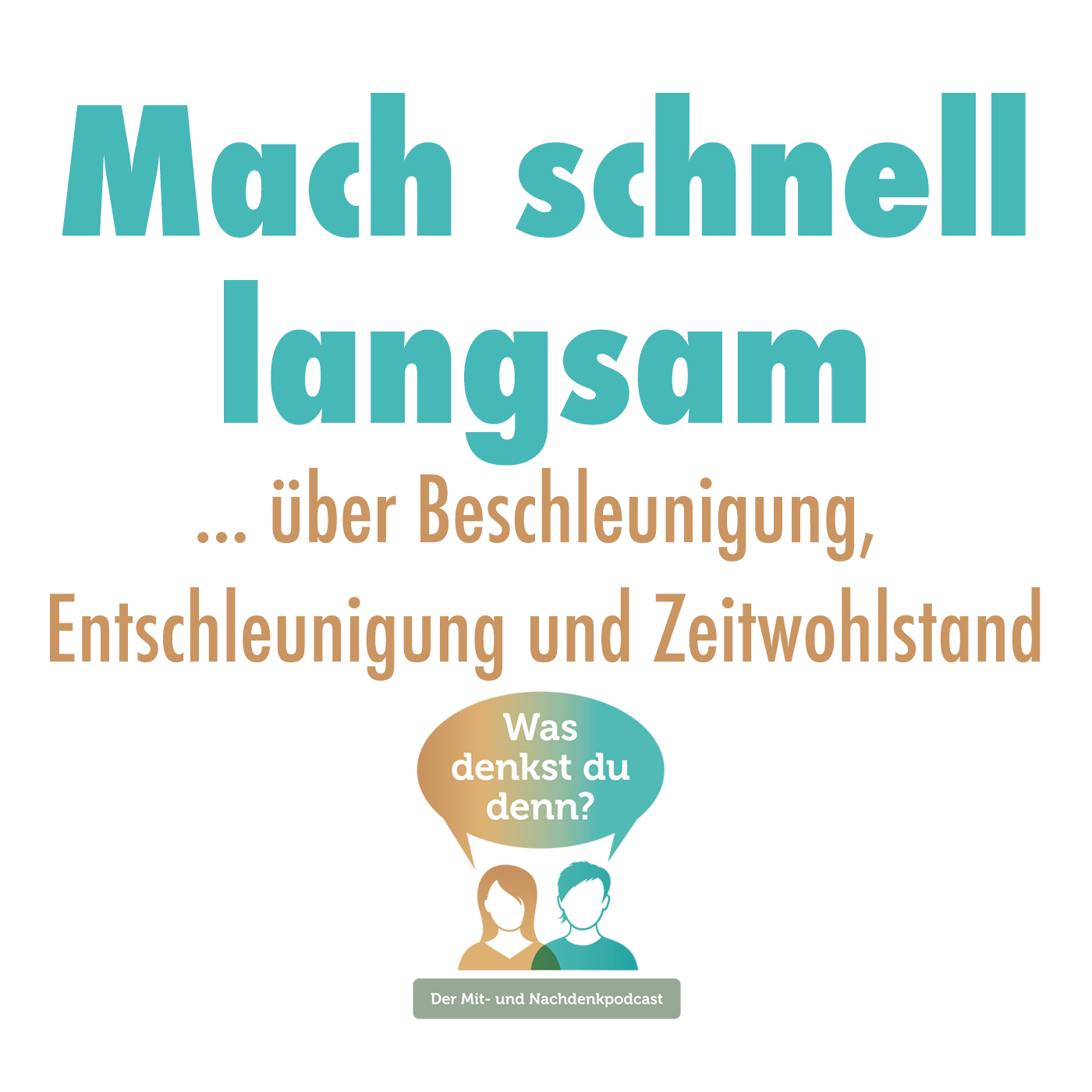dies ist eine Seite für
Kategorie: Podcast
In dieser Folge geht es um eine Serie, die in den 90ern das Frauenbild geprägt hat: Sex and the city. Und schon beim Titel wird es spannend. Denn es heißt nicht – wie oft fälschlich zitiert „Sex IN the city“, sondern „AND“. Und das macht eine Aussage über eine Wechselbeziehung zwischen Liebesleben und Leben in der Stadt. Oder eben gerade nicht in der Stadt. Welche das sind oder sein könnten, darüber sprechen wir in dieser Folge des „Was denkst du denn“ Podcasts.
Disclaimer: Wir sind von einer Hörerin gefragt worden, ob und wie wir uns bisher zum Krieg zwischen Israel und Gaza geäußert hätten. Vor allem in Bezug auf die Philosophin Judith Butler und ihre durchaus schwierigen Aussagen. Wir nehmen zu Beginn der Folge darauf Bezug. Und wollen euch hier in der Linkliste zudem noch ein paar Hörempfehlungen mitgeben.
Ritas Literaturliste:
- Brewis, Joanna (2004): Sex and Not the City? The Aspirations of the Thirty-Something Working Woman. In: Urban Studies 41, Nr. 9, S. 1821-1838.
- Carroll, Noël (2010). Consuming Passion: Sex and the City. In: Revue Internationale de Philosophie 64, Nr. 254, 4/2010, S. 525-546
- Edlund, Lena (2005): Sex and the City. In: The Scandinavian Journal of Economics 107, Nr. 1/2005, S. 25-44.
- Fritz, Sophia (2024): Toxische Weiblichkeit. Berlin: Hanser.
- Han, Byung-Chul (2012): Agonie des Eros. Berlin: Matthes & Seitz.
- Pfaller, Robert (2012): Zweite Welten Und andere Lebenselixiere. Frankfurt/Main: Fischer. (Hier: Kap. 2: „Sexualität und die Wahrheit der Stadt. Die philosophischen Lektionen von ‚Sex and the city‘“)
Noras Linktipps zur Folge:
- Tara-Louise Wittwer auf instagram: https://www.instagram.com/wastarasagt/
- Eros, Philia und Agape – Gespräche über Liebe Was denkst du denn? Podcast vom 30.08.2019
- Utopisches Klingeln – Wie wir den Nicht-Orten einen Platz einräumen Was denkst du denn? Podcast vom 03.11.2023
- Emmeline May and Blue Seat Studios: Tea Consent – Youtube-Clip vom 12.05.2015. Datum des letzten Abrufs 05.04.2024
Noras Linktipps zur Kritik an Judith Butler
- Palestinian Lives Matter Too: Jewish Scholar Judith Butler Condemns Israel’s “Genocide” in Gaza Interview vom 26.10.2023. Datum des letzten Abrufs 05.04.2024
- Cazés, Laura: Warum die Aussagen der amerikanischen Philosophin zum 7. Oktober und zur Rolle der Hamas brandgefährlich sind. Jüdische Allgemeine vom 11.03.2024. Datum des letzten Abrufs 05.04.2024
- Butler wehrt sich: Israel-Kritikerin reagiert auf Forderung, ihr den Adorno-Preis abzuerkennen Frankfurter Zeitung vom 03.04.2024
- Nach Antisemitismusvorwürfen Judith Butler reagiert auf Forderung nach Preis-Aberkennung Hessenschau vom 03.04.2024. Datum des letzten Abrufs 05.04.2024
Noras Linktipps zum Thema Krieg zwischen Israel und Gaza:
- Über Israel und Palästina sprechen Podcast von Shai Hoffmann mit verschiedenen Gästen
- Wie viel Aufmerksamkeit bekommt das Sterben in Gaza? Tausende Menschen sterben in Gaza. Wie viel Raum bekommt dieses Leid in der deutschen Öffentlichkeit? Darüber sprechen wir mit Salma Abuzaina von der deutsch-palästinensischen Gesellschaft und mit der Journalistin und Nahost-Expertin Kristin Helberg.
- Nahost-FrageDas Entweder-Oder der Solidarität Michael Roth (SPD) hat sich auf einer Nahostreise mit keinen Palästinenservertretern getroffen. Journalist Benjamin Hammer kritisiert die deutsche Regierung als undifferenziert pro-israelisch. Ein Streitgespräch. Deutschlandfunk. 20. Januar 2024. Datum des letzten Abrufs 05.04.2024
- Folge 38: Krieg in Nahost: Medien und Vielfaltsgesellschaft moderiert von Nils Minkmar und Nadia Zaboura. Civis Medienstiftung vom 30.11.2023
- Nahostkonflikt, Moral und Weihnachtsmann Die Anstalt vom 12.12.2023. ZDF Mediathek. Datum des letzten Abrufs 05.04.2024
- Fokus Nahost: Geteiltes Leid, geteilte EinsamkeitBilder der Zerstörung aus Gaza, tausende Tote – wie gehen Israelis damit um? Wie viel Aufmerksamkeit bekommen die Geiseln? Wir sprechen mit dem israelischen Journalisten Ofer Waldman und dem früheren ARD-Tel-Aviv-Korrespondenten Benjamin Hammer. Deutschlandfunk vom 23.12.2023. Datum des letzten Abrufs 05.04.2024
- Fokus Nahost: Wie lässt sich die Perspektive des anderen aushalten? Empathie für die Opfer des Hamas-Terrors und Empathie für getötete Zivilisten in Gaza. Wie kann das gelingen? Wir sprechen mit der Deutsch-Palästinenserin Jouanna Hassoun und dem deutschen Juden Shai Hoffmann – die mit Schülern über den Nahostkonflikt reden. Deutschlandfunk vom 16.12.2023. Datum des letzten Abrufs 05.04.2024
- Fokus Nahost: Wann endet der 7. Oktober für Israel? 240 Geiseln sind noch in der Hand der Hamas, aber die Welt blickt zunehmend entsetzt auf das Leid in Gaza. Warum sich die Israelis sehr alleine fühlen, darüber sprechen wir mit dem Soziologen Natan Sznaider und ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Deutschlandfunk vom 18.11.2023. Datum des letzten Abrufs 05.04.2024
- Fokus Nahost: Empathie, aber wie? Betrachten wir die zivilen Opfer in Gaza als Menschen zweiter Klasse? Diese Frage hat uns aus unserer Community erreicht. Über das Thema Mitgefühl sprechen wir mit dem Deutsch-Palästinenser Aref Hajjaj und dem Journalisten Moritz Behrendt. Deutschlandfunk vom 11.11.2023. Datum des letzten Abrufs 05.04.2024

Konflikte in Filmen, Videospielen oder Serien werden gerne auch mal mit Waffengewalt gelöst. Oder es gibt den einen Helden – oder die eine Heldin – auf die es am Ende ankommt. Dabei ist die Heldenerzählung eigentlich undemokratisch, befand schon Hegel.
Wir mäandern uns in dieser Folge durch verschiedene Erzählweisen, neue Prinzessinnen in Disney-Filmen, schwertkämpfende Pferde, Krieg und Waffengewalt in Kinderserien und beschäftigen uns mit der Frage, warum wir immer noch die eine Heldin oder den einen Helden ins Zentrum unserer Geschichten stellen.
P.S. Die Autoren zum Thema Heldenreise waren James Joyce und Joseph Campbell
Ritas Literaturliste:
- Barsotti, Susanna: The fairy tale: recent interpretations, female characters and contemporary rewriting. Considerations about an “irresistible” genre. In: Journal of Theories and Research in Education. 10 (2), 2015, S. 69-80. Online abrufbar unter https://www.researchgate.net/publication/307744308ThefairytalerecentinterpretationsfemalecharactersandcontemporaryrewritingConsiderationsaboutanirresistible_genre (Datum des letzten Abrufs: 02.03.2024)
- Bettelheim, Bruno: Kinder brauchen Märchen. 34. Auflage. München 2017. [Original 1977]
- Bröckling, Ulrich: Postheroische Helden – Ein Zeitbild. Berlin 2020. Hine, Benjamin/ Ivanovic, Katarina/ England, Dawn: „From the Sleeping Princess to the World-Saving Daughter of the Chief: Examining Young Children’s Perceptions of ‘Old’ versus ‘New’ Disney Princess Characters,“ Social Sciences, MDPI 7 (9), 2018, S. 1-15. Online abrufbar unter https://www.mdpi.com/2076-0760/7/9/161 (Datum des letzten Abrufs: 02.03.2024)
- Jünger, Ernst: Der Kampf als inneres Erlebnis. In: Sämtliche Werke. Band 7. Essays I. Stuttgart 1980. Online abrufbar unter https://archive.org/details/ernst-juenger-der-kampf-als-inneres-erlebnis-1926-106-s.-text/page/22/mode/2up (Datum des letzten Abrufs: 02.03.2024) [Original 1922]
- Kuon, Tricia/ Weimar, Holly: Wake Up Sleeping Beauty: Strong Heroines for Today’s World. In: Advancing Women in Leadership Journal. Huntsville 2009. Online abrufbar unter: https://www.researchgate.net/publication/240642177WakeUpSleepingBeautyStrongHeroinesforToday’s_World (Datum des letzten Abrufs: 02.03.2024)
- Nietzsche, Friedrich: Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten. (Hier vor allem Vortrag II). In: Kritische Gesamtausgabe, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Online abrufbar unter www.nietzschesource.org (Datum des letzten Abrufs: 02.03.2024) [Original 1872]
- Wardetzky, Kristin: „… die Märchen in den Ofen feuern!“ Der Märchenstreit im Nachkriegsdeutschland. In: Brinker-von der Heyde, Claudia et al. (Hrsg): Märchen, Mythen und Moderne. 200 Jahre Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Bd. 2. Frankfurt/Main u.a. 2015, S. 847–873.
Noras Linktipps:
- Tatort-Nacktszenen: Kinski gegen Ausstrahlung, ZDF.de vom 20.02.2024, abgerufen unter: https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/prominente/kinski-tatort-nackt-reifezeugnis-100.html. Datum des letzten Abrufs: 14.03.2024.
- Gantzke, Kira/Zengerling, Zita: Gegen das Schweigen – Machtmissbrauch bei Theater und Film. Veröffentlicht am 27.02.2024, verfügbar bis 27.02.2026. Datum des letzten Abrufs: 14.03.2024
- Hespers, Nora/Molzberger, Rita: Helden-Müll-Trennung – Über Helden, Idole und Vorbilder. Was denkst du denn? Podcast vom 25. September 2020
- Karig, Friedemann/El Ouassil, Samira: Erzählende Affen – Mythen, Lügen, Utopien. Wie Geschichten unser Leben beeinflussen. Berlin. 2021.

Liebe Was-denkst-du-denn?-Community, liebe Menschen, die durch den Podcast-Entdecker Newsletter des BR hier auf der Seite gelandet sind.
+ + + + + + + UPDATE + + + + + +
Jetzt ist sie endlich da! Die frische Folge „Was denkst du denn?“.
Rita wollte mal wieder ganz strukturiert und vorbereitet über ein Thema sprechen und hat sich deshalb das Thema „Macht“ gewünscht. Ein Fass(t) ohne Boden! Deshalb versuchen wir uns in dieser Folge erst mal einen Arbeitsbegriff von „Macht“ zurechtzulegen – um ihn dann in Folge zwei gnadenlos zu dekonstruieren. Oder so.
Worin liegt eigentlich Macht? Wer übt sie aus und wem gegenüber? In diesen beiden Fragen liegen schon zwei von sehr vielen möglichen Antworten. Macht hat etwas mit Beziehungen zu tun. Aber auch mit Diskurs. Und natürlich spielen auch menschengemachte Strukturen eine Rolle. Wir haben macht strukturell auf eine bestimmte Weise eingerichtet – und könnten sie – theoretisch – jederzeit auch wieder anders einrichten.
Ritas Literaturliste:
- Arendt, Hannah (2008): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus. 5. Auflage. München: Piper.
- Butler, Judith (2001): Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Fink, Eugen (1995): Grundphänomene des menschlichen Daseins. (Hier vor allem: Kapitel 17 und 18) 2. Auflage. Freiburg i.Br. und München: Verlag Karl Alber.
- Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. 9. Auflage. Frankfurt/Main 1994.
- Kleve, Heiko (2011): Vom Erweitern der Möglichkeiten. In: Pörksen, Bernhard (Hrsg.): Schlüsselwerke des Konstruktivismus. Wiesbaden: VS Verlag, S. 506–519.
- Kraus, Björn/ Krieger, Wolfgang (Hrsg.) (2021): Macht in der Sozialen Arbeit. Interaktionsverhältnisse zwischen Kontrolle, Partizipation und Freisetzung. 5. Auflage. Detmold: Jacobs Verlag.
- Kraus, Björn/ Sagebiel, Juliane (2021): Macht in der Sozialen Arbeit. In: socialnet Lexikon. Verfügbar unter: https://www.socialnet.de/lexikon/4143 [Datum des letzten Abrufs: 01.02.2024]
- Nietzsche, Friedrich: Zur Genealogie der Moral. Verfügbar unter: http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/GM (Datum des letzten Abrufs 01.02.2024)
- Staub-Bernasconi, Silvia (2019): Menschenwürde – Menschenrechte – Soziale Arbeit. Die Menschenrechte vom Kopf auf die Füße stellen. Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Staub-Bernasconi, Silvia (2021): Macht und (kritische) Soziale Arbeit. In: Kraus, Björn/ Krieger, Wolfgang (Hrsg.): Macht in der Sozialen Arbeit. A.a.O., S. 367–392.
Vorheriger Post Stand 25. Januar 2024
Das ist jetzt irgendwie doof gelaufen, ne, ausgerechnet dann keine frische Folge am Start zu haben, wenn so viele Menschen neu auf die Seite kommen. Aber: Keine Sorge, es gibt neue Folgen und es geht – natürlich – weiter. Nämlich am 9. Februar. Im Januar haben uns leider diverse Viren und Bakterien ein Bein gestellt. Die gute Nachricht: Auch unsere „alten“ Folgen bleiben aktuell. Versprochen.
Also schaut doch gerne mal hier vorbei – alles Folgen, die trotz älteren Datums immer noch gut zur aktuellen Situation passen
- Das Handwerk der Freiheit
- Geschwimmflügelte Worte
- Von Widerstand und Kritikäffchen
- Poligogik, Pädatik und diskursive Demokratie
- Hannah Arendt oder: Nichthandeln ist auch keine Lösung
Also, herzlich willkommen an alle Neuen und bis ganz bald hier oder im Podcatcher eurer Wahl!
Nora und Rita

Was ist eigentlich Glauben? Und was unterscheidet den philosophischen Glauben zum Beispiel vom religiösen Offenbarungsglauben und der Esoterik? Denn obwohl viele Menschen aus den Kirchen austreten – auf der Suche nach Orientierung durch Glauben sind sie weiterhin. Viele suchen daher Zuflucht in anderen Glaubensgemeinschaft oder Sekten. Oder ersetzen ihre verlorene Bindung durch anderes.
Wir versuchen in dieser Folge eine Abgrenzung, gehen auf die Suche nach Motiven für den Glauben an Esoterik und stellen die These auf, dass sich dem Glauben immer auch die Suche innewohnt und er sich deshalb kritisieren und befragen lassen muss.
Ritas Literaturliste:
- Altmeyer, Stefan: „‚Dass einer fiedelt, soll wichtiger sein, als was er geigt“ (Th. W. Adorno) – Religion und Bildung unter den Vorzeichen einer ‚Theorie der Unbildung‘. Abrufbar unter https://ub01.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/90944/Altmeyer_058.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Datum des letzten Abrufs: 30.11.2023)
- Barth, Claudia: Esoterische Selbsthilfe: Neue Wege zu Selbstsorge und Empowerment oder Preisgabe von Selbstbestimmung? In: Bildungsforschung Jahrgang7, Ausgabe 1/2010.
- Frost, Ursula: Einigung des geistigen Lebens. Zur Theorie religiöser und allgemeiner Bildung bei Friedrich Schleiermacher. Paderborn 1991.
- Jaspers, Karl: Der philosophische Glaube angesichts der christlichen Offenbarung. In: Philosophie und Christliche Existenz. Festschrift für Heinrich Barth zum 70. Geburtstag. Hrsg. von Gerhard Huber. Basel/Stuttgart 1960.
- Jaspers, Karl: Karl Jaspers: Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung. München 1962.
Noras Link- und Literaturtipps:
- Anouk, Misha: Goodbye Jehova – Wie ich die bekannteste Sekte der Welt verließ. Hamburg 2014.
- Lamberty, Pia / Nocun, Katharin: Gefährlicher Glaube – Die radikale Gedankenwelt der Esoterik. Köln 2022.
- Bücheler,Stefan / Halser, Marlene / Klingner, Susanne: Just Love – Bhakti Margas Guru und sein Geheimnis. Podcast. ARD Audiothek. Erstveröffentlichung: 10.01.2022 (Datum des letzten Abrufs: 08.12.2023)
Songs zum Thema:

Was sind eigentlich Utopien? Und warum soll es eigentlich hilfreich sein, mit einem U-Topos, also einem Nicht-Ort zu beschäftigen? Und wer wird an diesen Orten eigentlich mitgedacht – und wer eben auch nicht? Die Philosophin Rita Molzberger und die Journalistin Nora Hespers gehen in dieser Podcastfolge der Utopie auf den Grund, analysieren ihre politische Bedeutung und stellen vor allem die Frage, ob wir nicht bereits in einer Art Utopie leben.
Ritas Literaturliste:
- Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. München 1986.
- Augé, Marc: Nicht-Orte. 4. Auflage. München 2010.
- Comenius, Johann Amos: Das Labyrinth der Welt und Das Paradies des Herzens. Mit einem Vorwort von Pavel Kohout. Luzern 1970. [Orig. 1623]
- Fink, Eugen: Der Mensch als Fragment. In: Zur Krisenlage des modernen Menschen. Würzburg 1989, S. 29-47.
- Gehl, Jan: Leben zwischen Häusern. Berlin 2010.
- Greffrath, Mathias: Die Ideen sind da, doch wir sind noch nicht so weit. In: Deutschlandfunk „Essay und Diskurs“. 18.12. 2022. Abrufbar unter https://www.deutschlandfunk.de/die-ideen-sind-da-doch-wir-noch-nicht-so-weit-warum-utopien-100.html (Datum des letzten Abrufs: 26.10.2023)
- Höffe, Otfried: Vier Kapitel einer Wirkungsgeschichte der Politeia. In: Ders. (Hrsg.): Platon. Politeia. Reihe „Klassiker Auslegen“. Berlin 2005, S. 333-361.
- Morus, Thomas: Utopia. (De optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia) Übersetzt von Hermann Kothe. Köln 2007. [Orig. 1516]
- Platon: Politeia. In: Sämtliche Werke, Band 2. Reinbek bei Hamburg 2017.
- Sara, Rachel/Mosley, Jonathan: The Architecture of Transgression. Hoboken 2013.
- Schumpp, Mechthild: Stadtbau-Utopien und Gesellschaft. Gütersloh 1972.
- Sutter, Franz (Hrsg.): No future? Denkanstöße von Camus et al. Zürich 2010.
Dokumentationen:
- Gilman, Sylvie/ de Lestrade, Thierry: Die Revolution der Selbstlosen. 2016.
- Langbein, Kurt: Zeit für Utopien – Wir machen es anders. 2018.
Ritas Playlist:
- K.I.Z.: Hurra die Welt geht unter
- Ton Steine Scherben: Der Traum ist aus
- World Inferno Friendship Society: Only Anarchists Are Pretty
- Kummer feat. Fred Rabe: Der letzte Song
- Goldfrapp: Utopia
- Brooke Fraser: C. S. Lewis Song
- Alanis Morissette: Utopia
- Clueso: Utopie
- Billy Joel: Summer, Highland Falls
- David O’Dowda: The World Retreats
- Bernadette La Hengst: Her mit der Utopie
Noras Podcast-Tipps:
- Berbner, Bastian: 180 Grad – Geschichten gegen den Hass. Folge 4. 03.10.2019 (Datum des letzten Abrufs 29.10.2023)
- El Ouassil, Samira / Karig, Friedemann: Piratensender Powerplay. (Datum des letzten Abrufs 20.10.2023)
- Deutschlandfunk Kultur / ZDF kultur: Billion Dollar Apes – Kunst, Gier, NFTs. 15.06.2023 (Datum des letzten Abrufs 29.10.2023)
- Hespers, Nora / Molzberger, Rita: Akte(n) der Menschlichkeit – Vom Random Acts of Kindness und sozialer Phantasie. 14.10.2022. (Datum des letzten Abrufs 29.10.2023)
- Hespers, Nora / Molzberger, Rita: Re-sülli-änz – oder: Dem Grüßaugust seine Krisenbewältigung.. 10.09.2021 (Datum des letzten Abrufs 29.10.2023)
- Tran, Anh: Auf Heimatsuche. Deutschlandfunk. 01.09.2021 (Datum des letzten Abrufs 29.10.2023)

Eva von Redecker hat ein Buch über Bleibefreiheit geschrieben. Rita hat es gelesen und deshalb diskutieren wir über den Freiheitsbegriff aus der Perspektive des Bleibens. Im realen Leben, aber auch in solzialen Netzwerken. Wo wollen wir bleiben. Wo können wir bleiben?
Die Fragen nach der Bleibefreiheit sind auf vielen Ebenen drängend. Denn unsere Freiheiten haben Grenzen, die wir nicht einfach verschieben können. Wir haben zum Beispiel aufgrund unserer physiologischen Beschaffenheit nicht die Freiheit, einfach auf den Mond auszuwandern. Oder als Menschen da zu leben, wo es zu heiß oder zu kalt für uns ist. Vor dem Hintergrund stellt sich auch in der aktuellen Debatte um das Weltklima die Frage: Wo können wir noch bleiben?
Aber auch im Digitalen erleben wir eine Art Klimawandel. Hier stellt sich genauso die Frage danach, wo wir bleiben wollen oder können. Und wie wir unsere Welt im Digitalen gestalten möchten, damit möglichst viele bleiben können.
Ritas Literaturliste:
- Von Redecker, Eva: Bleibefreiheit. Frankfurt/Main 2023.
- Arendt, Hannah: Die Freiheit, frei zu sein. München 2018.
- Bourdieu, Pierre: Die verborgenen Mechanismen der Macht. Schriften zu Politik und Kultur 1. Hrsg. von Margareta Steinrücke. Hamburg 2015.
- Pfister, Jonas: Texte zur Freiheit. Stuttgart 2014.
- Sen, Amartya: Ökonomie für den Menschen. Wege zu Gerechtigkeit und Solidarität in der Marktwirtschaft. München 2000.
Noras Linkliste:
- Geschwimmflügelte Worte – Was denkst du denn? Folge 28 vom 05.02.2018
- Von Widerstand und Kritikäffchen – Was denkst du denn? Folge 29 vom 17.02.2018
- Das Handwerk der Freiheit – Was denkst du denn? Folge 34 vom 27.04.2018
- Hannah Arendt – Was denkst du denn? Folge 116 vom 02.07.2021
- Lochte, Paula: Endloser Flüchtlingstreck – Wie das aktuelle Spiegel-Cover die Realität verzerrt und Ängste schürt. BR2. 26.09.2023 (Datum des letzten Abrufs 07.10.2023)
- Zaboura, Nadia: Medien-Kritikerin: „Geflüchtete werden zu Objekten degradiert.

Ehrlich gesagt: Am Rande ihrer Kräfte waren viele Menschen schon vor der Corona-Pandemie. Währenddessen ist es für viele kein bisschen besser geworden, sondern eher schlimmer. Vor allem für Menschen in den Bereichen Care, Pflege und Erziehung.
Inzwischen sind wir wieder zurück in einer vermeintlichen Normalität. Und die Erschöpfungsursachen durch die Pandemie? Sind kein Thema mehr. Wir halten uns an greifbarere Erklärungen. Eine davon ist die Arbeitsbelastung. Und interessanterweise ist Erschöpfung im Kontext von Arbeit ja eher positiv konnotiert. Was machen wir also mit dem Erschöpfungsbegriff der Gegenwart?
Ritas Literaturliste:
- Arendt, Hannah: Vita activa oder Vom tätigen Leben. München. 2002.
- Han, Byung-Chul: Müdigkeitsgesellschaft. Berlin. 2010.
- Ehrenberg, Alain: Das erschöpfte Selbst – Depression und Gesellschaft in der Gegenwart. Frankfurt. 2015.
- Merleaut-Ponty, Maurice: Das Auge und der Geist. Hamburg. 2003
- Menke, Christoph / Rebentisch, Juliane [Hrsg.]: Kreation und Depression – Freiheit im Gegenwärtigen Kapitalismus. Berlin. 2012.
Noras Podcast- und Literaturtipps:
- El Ouassil, Samira / Karig, Friedemann: Erzählende Affen. Mythen, Lügen, Utopien – Wie Geschichten unser Leben bestimmen. Berlin. 2021.
- El Ouassil, Samira / Karig, Friedemann: Piratensender Powerplay. Selfhosted Podcast. Wöchentlich.
- El Ouassil, Samira / Stenger, Christiane: Sag niemals Nietzsche. Audible. 2019.
- Hespers, Nora / Wolff, Matthias: Sport und Klima 4 – Amateursport. WDR Sport inside Podcast. ARD Audiothek. 2023

Wenn wir in religiösen Bezügen aufgewachsen sind, dann ist es schwer daraus auszusteigen. Selbst dann, wenn wir selbst nicht religiös sind, Religion nicht leben wollten oder konnten. Denn Religion gehört zu unserem Alltag – und sei es nur in Form von religiösen Gebäuden in unserer Umgebung. Was also macht Religion mit uns? Was ist fromm und was nur frömmelnd? Und wie lagert sich Spiritualität da ein?
Eins gleich vorweg: Wir sprechen hier vornehmlich über das Katholischsein, weil Rita und Nora beide katholisch sind. Und wir sprechen über Noras bevorstehenden Kirchenaustritt. Der Gedanke aber ist: Was bleibt, wenn wir den formalen Akt des Austritts begehen? Aus was treten wir da aus und aus was eben nicht? Wozu dient Religion den Menschen? Warum gibt es dieses universelle Streben nach Religion und Zugehörigkeit? Das sind die Fragen, die uns in dieser Folge beschäftigen.
Ritas Literaturliste:
- Breul, Martin/ Langenfeld, Aaron (Hrsg.): Kleine Philosophiegeschichte. Eine Einführung für das Theologiestudium. Paderborn: Brill. 2017.
- Casale, Rita: Heideggers Nietzsche. Geschichte einer Obsession. Bielefeld: transcript. 2010.
- Frost, Ursula: Einigung des geistigen Lebens. Zur Theorie religiöser und allgemeiner Bildung bei Friedrich Schleiermacher. Paderborn: Schöningh. 1991. Kantzenbach, Friedrich Wilhelm: Schleiermacher. Reinbek bei Hamburg; Rowohlt. 1967.
- Kast, Christina: Friedrich Nietzsches Ja zum Leben. Würzburg: Königshausen und Neumann. 2019.
- Nietzsche, Friedrich: Zur Genealogie der Moral. In: KSA, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Band 5. München/Berlin/New York: de Gruyter. 1999.
- Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst: Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. In der Ausgabe von Rudolf Otto. 8. Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 2002. [Original 1799]
Noras Lesetipp:
Florin, Christiane: Trotzdem! Wie ich versuche, katholisch zu bleiben. München: Kösel. 2020.
Playlist:
- Eric Idle: Always look on the bright side of life
- Die Ärzte: Waldspaziergang mit Folgen
- Kraftklub: Kein Gott, kein Staat, nur Du
- R.E.M.: Losing my religion
- Robbie Williams: Sin Sin Sin
- Leonard Cohen / K.D. Lang: Hallelujah
- Bach, Johann Sebastian: Magnificat in D (BWV 243)
Wer mag findest diese Songs in unserer Spotify-Playlist zur Folge: „Artistenmetaphysik„

„Wie privilegiert kann man sein?“ – Dieser Satz hat jemanden in einem sozialen Jobnetzwerk zu einem Post veranlasst. Ein Post, in dem durchaus Wut über diesen Satz herauszulesen war. Aber warum fühlen wir uns eigentlich angegriffen, wenn wir auf unsere Privilegien angesprochen werden? Woher kommen diese Abwehr- und Verteidigungsmechanismen? Wir wollen in dieser Folge das Privileg beleuchten und warum es so schwer ist, aus dem Privilegien-Quartett auszusteigen.
Aber wenn wir nicht aussteigen können aus unseren Privilegien. Wenn sie sogar mehr werden, je mehr wir darüber reflektieren, je mehr Bewusstsein wir über sie erlangen – was machen wir denn dann damit? Das ist eine gar nicht mal so leichte Frage. Denn sie geht auch mit Schuld (Adorno) und Verantwortung einher.
Ritas Literaturliste:
- Adorno, Theodor W.: Theorie der Halbbildung. In: Busch, Alexander (Hrsg.): Soziologie und moderne Gesellschaft: Verhandlungen des 14. Deutschen Soziologentages vom 20. bis 24. Mai 1959 in Berlin (S. 169-191). 1959. Abrufbar unter https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/18760/ssoar-1959-adorno-theorie_der_halbbildung.pdf?sequence=1 (Datum des letzten Abrufs: 02.04.2023)
- Blumenberg, Hans: Die nackte Wahrheit. Hrsg. von Rüdiger Zill. Berlin 2019.
- Hering, Sabine: Makel, Mühsal, Privileg? Eine hundertjährige Geschichte des Alleinerziehens. Frankfurt/Main 1998.
- Lenski, Gerhard: Macht und Privileg. Eine Theorie der sozialen Schichtung. Übersetzt von Hanne Herkommer. Frankfurt/Main 1977.
- McIntosh, Peggy (1990): White Privilege: Unpacking the Invisible Knapsack. In: Independent School, Winter 1990, 31-36. Abrufbar unter: https://psychology.umbc.edu/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/White-Privilege_McIntosh-1989.pdf (Datum des letzten Abrufs: 01.04.2023).
- Schütte, André: Verwoben und ambivalent. Das Verhältnis von Bildung und Konsum in der Kultur der Moderne. 2018. Abrufbar unter: https://www.kubi-online.de/index.php/artikel/verwoben-ambivalent-verhaeltnis-bildung-konsum-kultur-moderne (Datum des letzten Abrufs: 02.04.2023)
- Shehadeh, Nadia: Hä, was heißt denn Privilegien? In: Missy Magazine 2017. Abrufbar unter https://missy-magazine.de/blog/2017/08/01/hae-was-heisst-denn-privilegien/ (Datum des letzten Abrufs: 01.04.2023)
Noras Literaturtipp:
- Endler, Rebekka: Das Patriarchat der Dinge – Warum die Welt Frauen nicht passt. Köln 2021.

Wir leben in rasenden Zeiten. Und viele von uns spüren: Es wäre an der Zeit, mal langsam zu machen. Aber schnell. Klingt paradox – ist es an vielen Stellen auch. Denn es geht nicht nur um die Entschleunigung als solche, sondern auch um die Beschleunigung von Prozessen und vor allem Strukturen, die uns das Entschleunigen überhaupt ermöglichen. Ihr merkt schon. Es ist kompliziert, aber auch ganz schön unterhaltsam, sich damit zu beschäftigen, wo wir welches Tempo brauchen, damit möglichst viele Menschen ein gutes Leben haben können.
Ritas Literaturliste:
- Backhaus, Klaus/ Bonus, Holger (Hrsg.): Die Beschleunigungsfalle oder der Triumph der Schildkröte. Stuttgart 1997.
- Dörpinghaus, Andreas: Schonräume der Langsamkeit. In: Brinkmann, Malte (Hrsg.): Phänomenologische Erziehungswissenschaft von ihren Anfängen bis heute. Wiesbaden 2019, S. 457–464. (Orig. 2008)
- King, Vera/ Gerisch, Benigna (Hrsg.): Zeitgewinn und Selbstverlust. Folgen und Grenzen der Beschleunigung. Frankfurt/Main, New York 2009.
- Nadolny, Sten: Die Entdeckung der Langsamkeit. München 1983.
- Pfeiffer, Ursula: Kontinuität und Kontingenz. Zeitlichkeit als reflexive Dimension für die Erziehungswissenschaft. In: Schmidt-Lauff, – Sabine (Hrsg.): Zeit und Bildung. Annäherungen an eine zeittheoretische Grundlegung. Münster, New York, München, Berlin 2012, S- 91-112.
- Rosa, Hartmut: Beschleunigung und Entfremdung. Berlin 2013.
- Virilio, Paul: Fahren, fahren, fahren. Berlin 1978.
Noras Link- und Buchtipps:
- Führt mehr Zeit zu nachhaltigerem Konsum?. Hörsaal. Deutschlandfunk Nova vom 10.02.2023 (Datum des letzten Abrufs 9.3.2023)
- Shehadeh, Nadia: Anti-Girlboss – Den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. Berlin 2023.