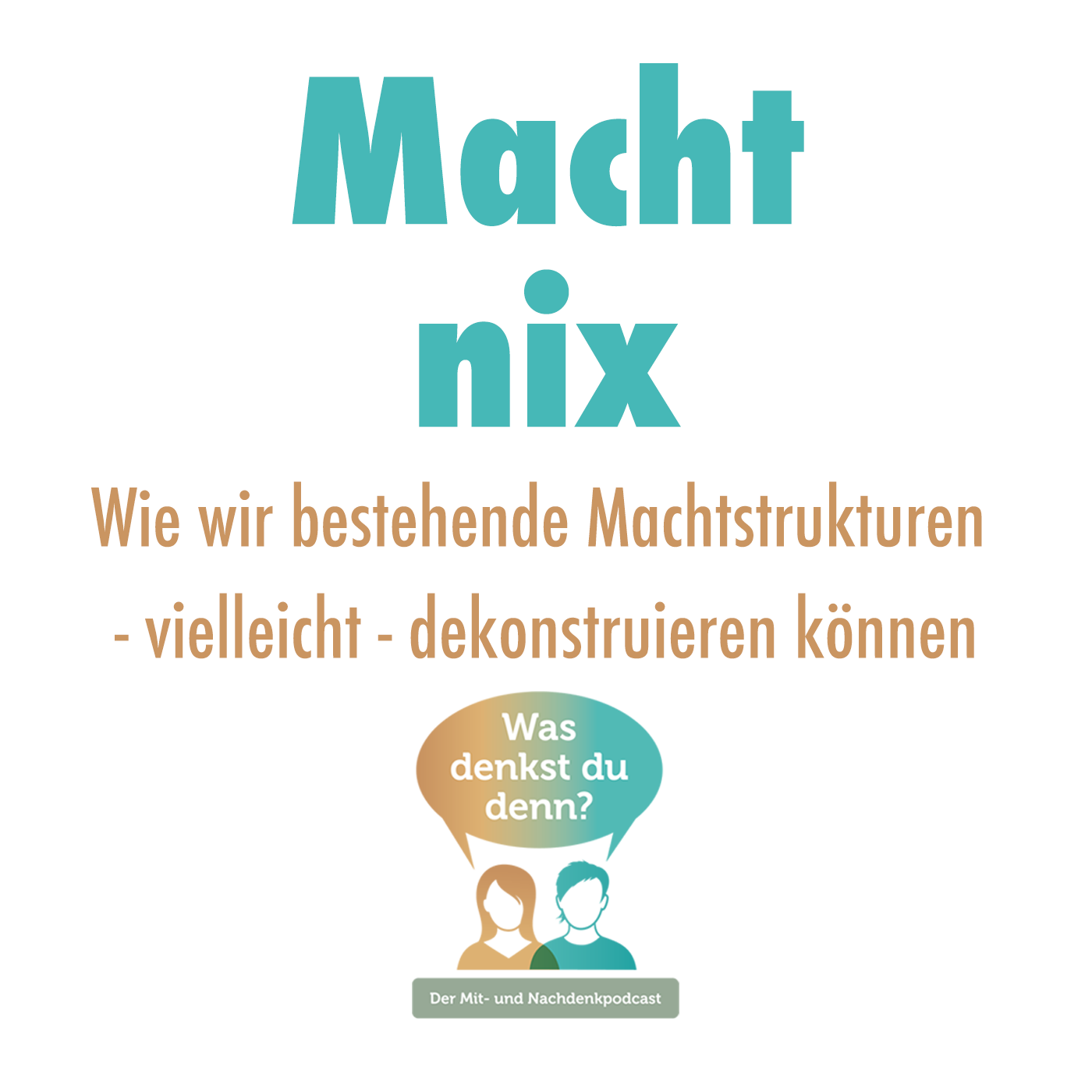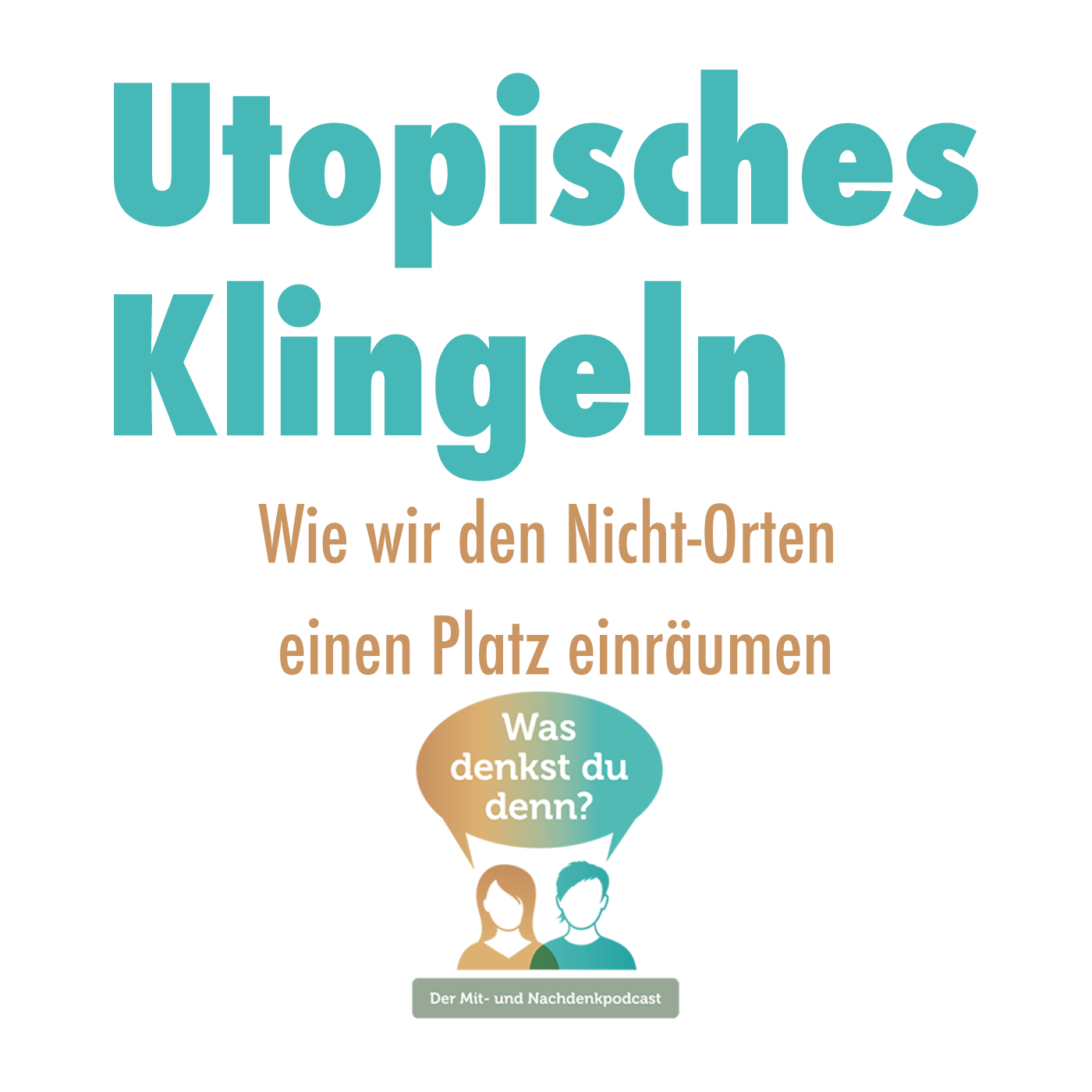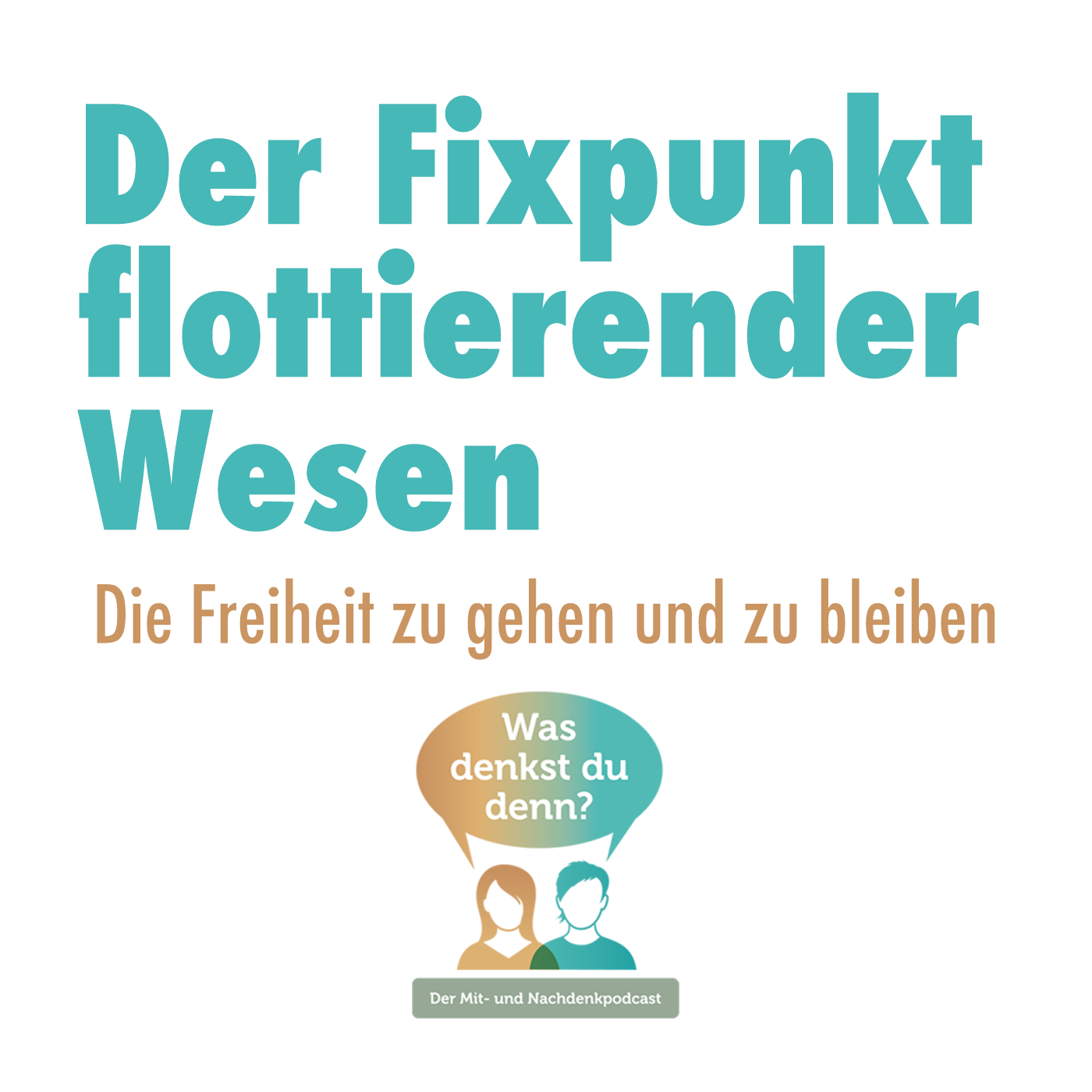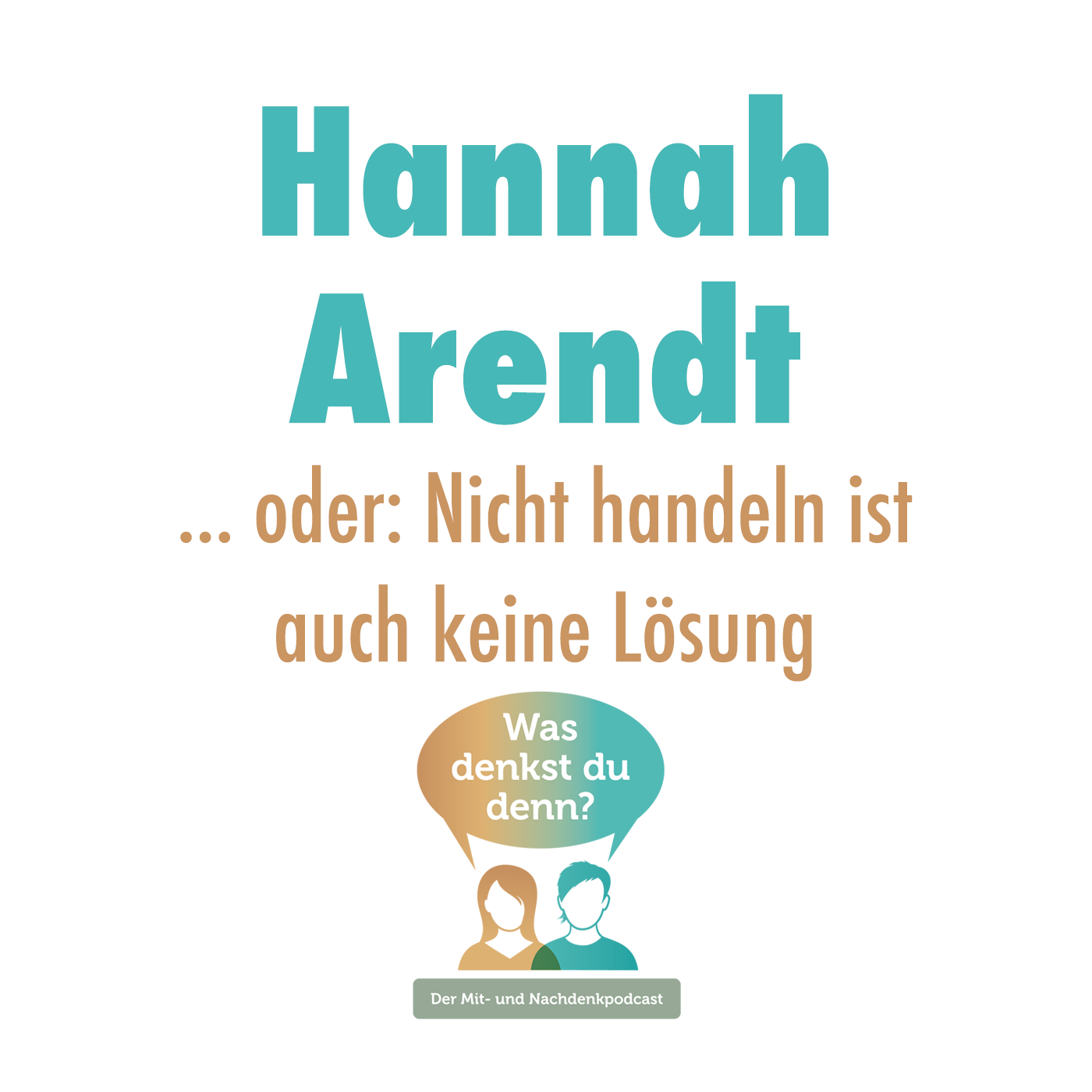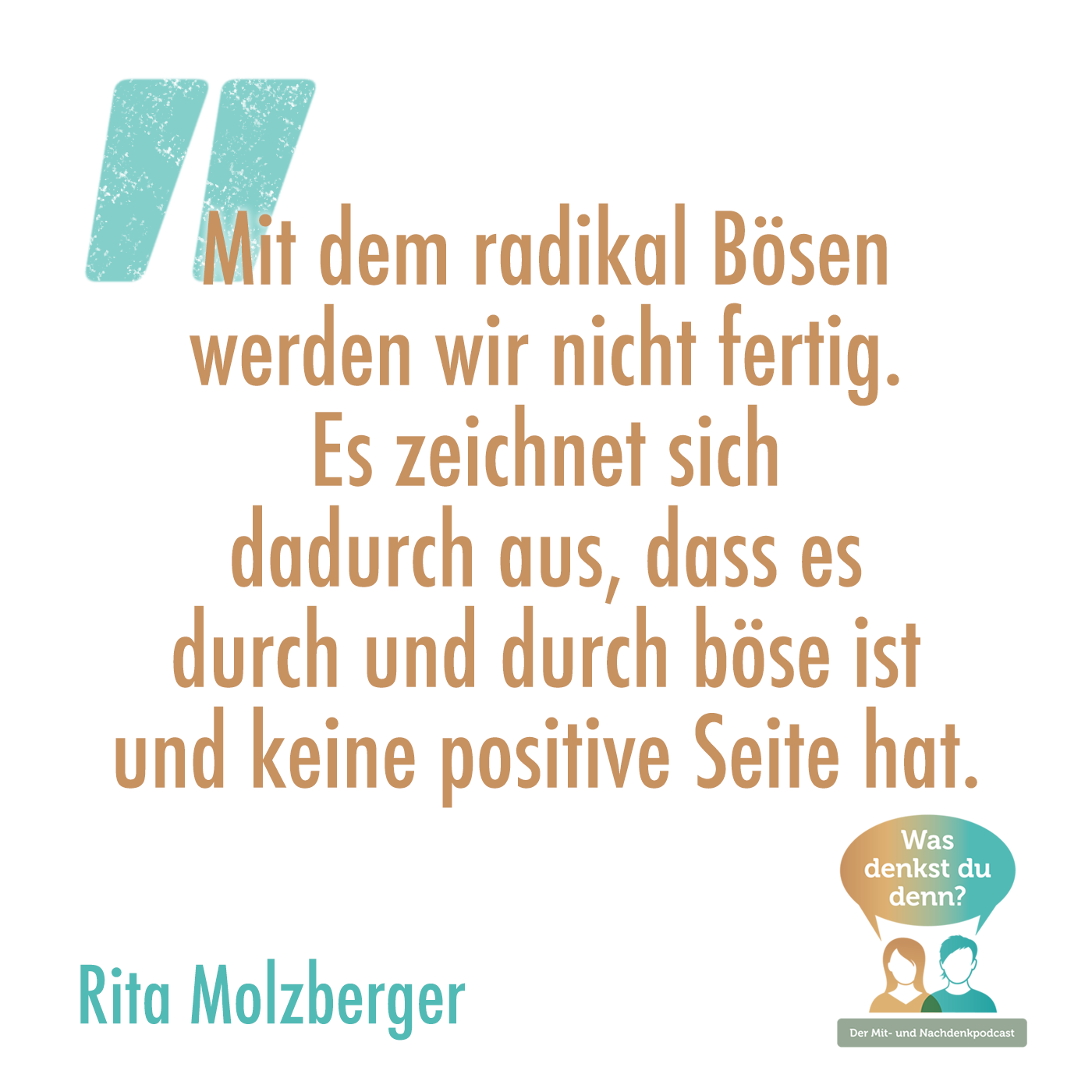dies ist eine Seite für
Browsing Tag: Hannah Arendt
Was ist eigentlich Macht – darüber haben wir in Folge 1 gesprochen. In dieser Folge – der Folge 2 zur Macht – wollen wir darüber nachdenken, wie wir die verhandenen Strukturen dekonstruieren können. Es geht um Machtverteilung und auch darum, Macht zu teilen. Aber wie geht das am besten? Und für wen sind macht- und verantwortungsvolle Positionen eigentlich warum attraktiv?
Ritas Literaturliste:
- Arendt, Hannah (2008): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus. 5. Auflage. München: Piper.
- Butler, Judith (2001): Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Fink, Eugen (1995): Grundphänomene des menschlichen Daseins. (Hier vor allem: Kapitel 17 und 18) 2. Auflage. Freiburg i.Br. und München: Verlag Karl Alber.
- Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. 9. Auflage. Frankfurt/Main 1994.
- Kleve, Heiko (2011): Vom Erweitern der Möglichkeiten. In: Pörksen, Bernhard (Hrsg.): Schlüsselwerke des Konstruktivismus. Wiesbaden: VS Verlag, S. 506–519.
- Kraus, Björn/ Krieger, Wolfgang (Hrsg.) (2021): Macht in der Sozialen Arbeit. Interaktionsverhältnisse zwischen Kontrolle, Partizipation und Freisetzung. 5. Auflage. Detmold: Jacobs Verlag.
- Kraus, Björn/ Sagebiel, Juliane (2021): Macht in der Sozialen Arbeit. In: socialnet Lexikon. Verfügbar unter: https://www.socialnet.de/lexikon/4143 [Datum des letzten Abrufs: 01.02.2024]
- Nietzsche, Friedrich: Zur Genealogie der Moral. Verfügbar unter: http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/GM (Datum des letzten Abrufs 01.02.2024)
- Staub-Bernasconi, Silvia (2019): Menschenwürde – Menschenrechte – Soziale Arbeit. Die Menschenrechte vom Kopf auf die Füße stellen. Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Staub-Bernasconi, Silvia (2021): Macht und (kritische) Soziale Arbeit. In: Kraus, Björn/ Krieger, Wolfgang (Hrsg.): Macht in der Sozialen Arbeit. A.a.O., S. 367–392.
Noras Linktipp:
- Feminist Shelf Control – Podcast mit Annika Brockschmidt und Rebekka Endler

Was sind eigentlich Utopien? Und warum soll es eigentlich hilfreich sein, mit einem U-Topos, also einem Nicht-Ort zu beschäftigen? Und wer wird an diesen Orten eigentlich mitgedacht – und wer eben auch nicht? Die Philosophin Rita Molzberger und die Journalistin Nora Hespers gehen in dieser Podcastfolge der Utopie auf den Grund, analysieren ihre politische Bedeutung und stellen vor allem die Frage, ob wir nicht bereits in einer Art Utopie leben.
Ritas Literaturliste:
- Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. München 1986.
- Augé, Marc: Nicht-Orte. 4. Auflage. München 2010.
- Comenius, Johann Amos: Das Labyrinth der Welt und Das Paradies des Herzens. Mit einem Vorwort von Pavel Kohout. Luzern 1970. [Orig. 1623]
- Fink, Eugen: Der Mensch als Fragment. In: Zur Krisenlage des modernen Menschen. Würzburg 1989, S. 29-47.
- Gehl, Jan: Leben zwischen Häusern. Berlin 2010.
- Greffrath, Mathias: Die Ideen sind da, doch wir sind noch nicht so weit. In: Deutschlandfunk „Essay und Diskurs“. 18.12. 2022. Abrufbar unter https://www.deutschlandfunk.de/die-ideen-sind-da-doch-wir-noch-nicht-so-weit-warum-utopien-100.html (Datum des letzten Abrufs: 26.10.2023)
- Höffe, Otfried: Vier Kapitel einer Wirkungsgeschichte der Politeia. In: Ders. (Hrsg.): Platon. Politeia. Reihe „Klassiker Auslegen“. Berlin 2005, S. 333-361.
- Morus, Thomas: Utopia. (De optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia) Übersetzt von Hermann Kothe. Köln 2007. [Orig. 1516]
- Platon: Politeia. In: Sämtliche Werke, Band 2. Reinbek bei Hamburg 2017.
- Sara, Rachel/Mosley, Jonathan: The Architecture of Transgression. Hoboken 2013.
- Schumpp, Mechthild: Stadtbau-Utopien und Gesellschaft. Gütersloh 1972.
- Sutter, Franz (Hrsg.): No future? Denkanstöße von Camus et al. Zürich 2010.
Dokumentationen:
- Gilman, Sylvie/ de Lestrade, Thierry: Die Revolution der Selbstlosen. 2016.
- Langbein, Kurt: Zeit für Utopien – Wir machen es anders. 2018.
Ritas Playlist:
- K.I.Z.: Hurra die Welt geht unter
- Ton Steine Scherben: Der Traum ist aus
- World Inferno Friendship Society: Only Anarchists Are Pretty
- Kummer feat. Fred Rabe: Der letzte Song
- Goldfrapp: Utopia
- Brooke Fraser: C. S. Lewis Song
- Alanis Morissette: Utopia
- Clueso: Utopie
- Billy Joel: Summer, Highland Falls
- David O’Dowda: The World Retreats
- Bernadette La Hengst: Her mit der Utopie
Noras Podcast-Tipps:
- Berbner, Bastian: 180 Grad – Geschichten gegen den Hass. Folge 4. 03.10.2019 (Datum des letzten Abrufs 29.10.2023)
- El Ouassil, Samira / Karig, Friedemann: Piratensender Powerplay. (Datum des letzten Abrufs 20.10.2023)
- Deutschlandfunk Kultur / ZDF kultur: Billion Dollar Apes – Kunst, Gier, NFTs. 15.06.2023 (Datum des letzten Abrufs 29.10.2023)
- Hespers, Nora / Molzberger, Rita: Akte(n) der Menschlichkeit – Vom Random Acts of Kindness und sozialer Phantasie. 14.10.2022. (Datum des letzten Abrufs 29.10.2023)
- Hespers, Nora / Molzberger, Rita: Re-sülli-änz – oder: Dem Grüßaugust seine Krisenbewältigung.. 10.09.2021 (Datum des letzten Abrufs 29.10.2023)
- Tran, Anh: Auf Heimatsuche. Deutschlandfunk. 01.09.2021 (Datum des letzten Abrufs 29.10.2023)

Eva von Redecker hat ein Buch über Bleibefreiheit geschrieben. Rita hat es gelesen und deshalb diskutieren wir über den Freiheitsbegriff aus der Perspektive des Bleibens. Im realen Leben, aber auch in solzialen Netzwerken. Wo wollen wir bleiben. Wo können wir bleiben?
Die Fragen nach der Bleibefreiheit sind auf vielen Ebenen drängend. Denn unsere Freiheiten haben Grenzen, die wir nicht einfach verschieben können. Wir haben zum Beispiel aufgrund unserer physiologischen Beschaffenheit nicht die Freiheit, einfach auf den Mond auszuwandern. Oder als Menschen da zu leben, wo es zu heiß oder zu kalt für uns ist. Vor dem Hintergrund stellt sich auch in der aktuellen Debatte um das Weltklima die Frage: Wo können wir noch bleiben?
Aber auch im Digitalen erleben wir eine Art Klimawandel. Hier stellt sich genauso die Frage danach, wo wir bleiben wollen oder können. Und wie wir unsere Welt im Digitalen gestalten möchten, damit möglichst viele bleiben können.
Ritas Literaturliste:
- Von Redecker, Eva: Bleibefreiheit. Frankfurt/Main 2023.
- Arendt, Hannah: Die Freiheit, frei zu sein. München 2018.
- Bourdieu, Pierre: Die verborgenen Mechanismen der Macht. Schriften zu Politik und Kultur 1. Hrsg. von Margareta Steinrücke. Hamburg 2015.
- Pfister, Jonas: Texte zur Freiheit. Stuttgart 2014.
- Sen, Amartya: Ökonomie für den Menschen. Wege zu Gerechtigkeit und Solidarität in der Marktwirtschaft. München 2000.
Noras Linkliste:
- Geschwimmflügelte Worte – Was denkst du denn? Folge 28 vom 05.02.2018
- Von Widerstand und Kritikäffchen – Was denkst du denn? Folge 29 vom 17.02.2018
- Das Handwerk der Freiheit – Was denkst du denn? Folge 34 vom 27.04.2018
- Hannah Arendt – Was denkst du denn? Folge 116 vom 02.07.2021
- Lochte, Paula: Endloser Flüchtlingstreck – Wie das aktuelle Spiegel-Cover die Realität verzerrt und Ängste schürt. BR2. 26.09.2023 (Datum des letzten Abrufs 07.10.2023)
- Zaboura, Nadia: Medien-Kritikerin: „Geflüchtete werden zu Objekten degradiert.

Die erste Philosophin, mit der Nora in Berührung gekommen ist, war Hannah Arendt. Ihre Bücher hat sie bisher allerdings nicht gelesen, aber einige ihrer Gespräche hat sie inzwischen gehört und gesehen. Rita als Philosophin hat sich hingegen eingehender mit Hannah Arendt beschäftigt – und auch mit der Kritik an der politischen Denkerin, die gar nicht Philosophin genannt werden wollte.
In dieser Podcastfolge stellt Rita vor allem die Art vor, wie Hannah Arendt gedacht hat. Wir beschäftigen uns mit ihren Thesen zur Arbeit, ihrem Leben, aber auch ihrer Art der Gesprächsführung und Äußerung. Denn Hannah Arendt hat sich vor allem als politische Denkerin verstanden, die sich mit dem Leben der Menschen beschäftigt, mit ihrem Alltag. Auch wenn ihr genau das von ihren Kritiker:innen immer abgesprochen wurde. Wir blicken auf die Kritik an Hannah Arendt zum Eichmann-Prozess und ihrer Theorie der „Banalität des Bösen“, auf die Beweggründe, sich mit der vita activa des Menschen zu beschäftigen, also dem tätigem Leben und ihre Art, nicht nur zu denken, sondern auch zu urteilen.
Ritas Literaturliste:
- Kritische Gesamtausgabe der Werke Hannah Arendts: https://www.arendteditionprojekt.de/ (Datum des letzten Abrufs: 23.06.2021)
- Benhabib, Seyla: Hannah Arendt – Die melancholische Denkerin der Moderne. Erweiterte Ausgabe. Frankfurt/Main 2006.
- Breier, Karl-Heinz: Hannah Arendt zur Einführung. Hamburg 2011.
- Jaeggi, Rahel: Wie weiter mit … Hannah Arendt. Hrsg. von: Hamburger Institut für Sozialforschung. Hamburg 2016.
- Krimstein, Ken: Die drei Leben der Hannah Arendt. Graphic Novel, übersetzt von Hanns Zischler. München 2018.
- Schilling, Johannes/Klus, Sebastian: Soziale Arbeit. Geschichte – Theorie – Profession. 7. Auflage. München 2018, S. 103
- Straßenberger, Grit: Hannah Arendt zur Einführung. Hamburg 2020.
Noras Linkliste:
- Urteil des Bundesgerichtshofs zum Mindestlohn von ausländischen Pflegekräften. Tagesschau.de vom 24. Juni 2021 (Datum des letzten Abrufs 01.07.2021)
- Nach Diskussionen um Regenbogenbeleuchtung: Eure Regenbögen reichen nicht!. Kolumne der Sportjournalistin Mara Pfeiffer. web.de vom 24. Juni 2021 (Datum des letzten Abrufs 01.07.2021)

Es gibt Dinge, an deren finaler Erklärung wir scheitern. Liebe zum Beispiel. Oder Tod. Und auch das abgrundtief Böse und Monströse gehören dazu. Das sind die Dinge, die wir letzten Endes nicht begreifen können. Oder wie Rita es sagt: Nicht verdauen. Und trotzdem lohnt sich der Versuch, sich diesen Dingen zu nähern. Sie zu betrachten und anzuschauen. Der Anlass für dieses Gespräch ist hoch aktuell. Denn das Attentat in Halle am 09. Oktober 2019 war für viele Menschen eine Zäsur. Da hat sich ein Abgrund aufgetan. Und in den wollen wir blicken. Vorsichtig. Und da unser Gespräch am 31. Oktober stattfand – für die einen der Reformationstag, für andere einfach Halloween – fanden wir, das sei ein guter Tag, um die Brücke zu schlagen zwischen dem Bösen, dem Monströsen – aber eben auch der Banalität, die dem Bösen bisweilen zugrunde liegt und die dennoch monströse Ausmaße annehmen kann. Gast in dieser Folge ist der Philosoph Dr. Matthias Burchardt von der Universität in Köln.
Ritas Literaturliste
mit Ergänzungen von Matthias Burchardt:
- Anders, Günther: Wir Eichmannsöhne. München 2001.
- Arendt, Hannah: Eichmann in Jerusalem. 15. Auflage. München/ Zürich 2006.
- Bollnow, Otto Friedrich: Neue Geborgenheit. Neue Geborgenheit. Das Problem einer Überwindung des Existentialismus. Schriften, Band 5. Würzburg 2011.
- Montaigne, Michel de: Die Essais. Köln 2005. Stegemann, Bernd: Die Moralfalle: Für eine Befreiung linker Politik. Berlin 2018.
- Nelson, Maggie: The Art of Cruelty. A Reckoning. New York/ London 2011.
- Nietzsche, Friedrich: „Jenseits von Gut und Böse“ und „Zur Genealogie der Moral“. KSA Band 5. München 1999. Philosophie Magazin, Sonderausgabe 11: Was ist das Böse? Berlin 2018.
- Ricoeur, Paul: Das Böse: Eine Herausforderung für Philosophie und Theologie. Zürich 2006.
- Safranski, Rüdiger: Das Böse oder das Drama der Freiheit. 10. Auflage. Frankfurt/Main 1999.
- Schäfer, Christian (Hrsg.): Was ist das Böse? Philosophische Texte von der Antike bis zur Gegenwart. Stuttgart 2014.
- Svendsen, Lars: A Philosophy of Evil. Champaign/ London/ Dublin 2010.
- Žižek, Slavoj: Grimassen des Realen. Jacques Lacan oder die Monstrosität des Aktes. Köln 1993.
- Žižek, Slavoj: Der neue Klassenkampf. Die wahren Gründe für Flucht und Terror. 2015.

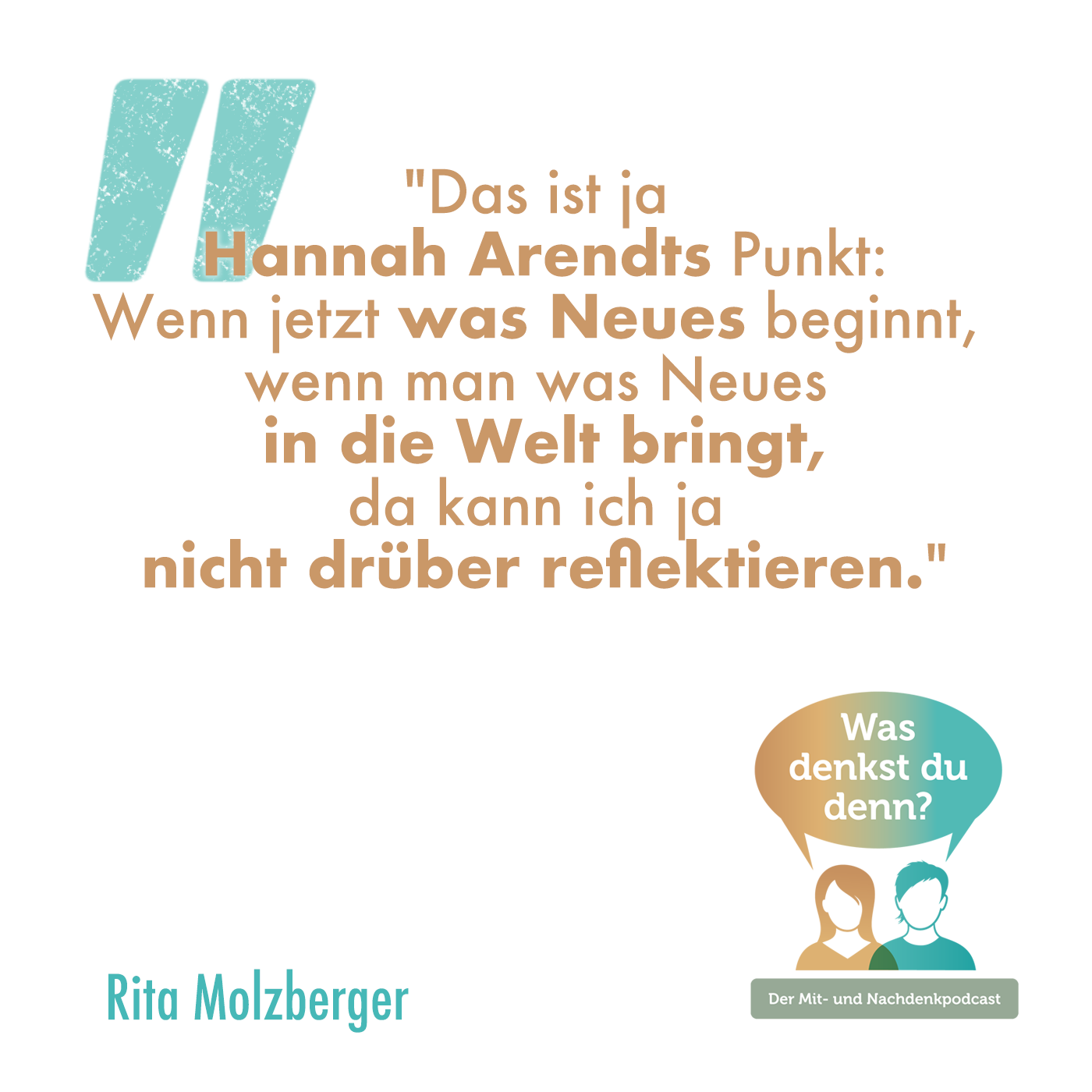
Das eurozentristische Weltbild denkt das Leben gerne mal vom Tod her. Ist auch irgendwie logisch, weil da können wir ja auch jede Menge Ereignisse zurückblicken und die schön fein gedanklich analysieren und sezieren. Ist nur halt auch eine ziemlich trübe Angelegenheit. Und deshalb machen wir das diesmal anders und denken das Leben vom Neubeginn her. Von der Geburt. Wobei es nicht zwingend darum geht, ein Kind auf die Welt zu bringen. Schließlich können wir auch mit Ideen schwanger gehen – und daraus Neues gebären. Ein Projekt zum Beispiel. Ein neues Hobby. Eine lebensverändernde Entscheidung. Aber das Neue bringt halt auch Chaos mit sich. Wir müssen uns in neue Rollen finden, neue Techniken erlernen, neue Wege beschreiten, neu denken.
Zu Gast haben wir deshalb diesmal die Hebamme Alexandra Kozma. Sie hilft Frauen nicht nur dabei, ein Kind auf die Welt zu bringen. Sie unterstützt auch Paare darin, Eltern zu werden und sich in die neuen Rollen als Mütter oder Väter reinzufinden. Denn auch das ist ja ein Werden. Mit ihr zusammen blicken wir auf das Leben von der Geburt her. Und natürlich sprechen wir auch darüber, wer eigentlich die Verantwortung für das neue Leben trägt – und die Risiken, die das mit sich bringt.
Übrigens: Die Hebammenkunst ist gar nicht so weit entfernt von der Philosophie. Denn schon die Mutter von Sokrates war – richtig – Hebamme.
Ritas Literaturliste
- Arendt, Hannah: Vita activa. 6. Auflage. München 2007.
- Baumann, Zygmunt: Retrotopia. (Hier insbes.: Kap. 4 „Zurück in den Mutterleib“.) Berlin 2017.
- Bröckling, Ulrich: Über Kreativität. Ein Brainstorming. In: Ders.: Gute Hirten führen sanft. Über Menschenregierungskünste. 2. Auflage. Frankfurt/Main 2017.
- Burchardt, Matthias: Hebammen in der ‚midwife-crisis‘? Ungehörige Gedanken zum Professionalisierungsmärchen. In: Müller C./Mührel E./Birgmeier B. (eds) Soziale Arbeit in der Ökonomisierungsfalle? Soziale Arbeit in Theorie und Wissenschaft. Wiesbaden: Springer VS. 2016.
- Dörpinghaus, Sabine: Dem Gespür auf der Spur. Leibphänomenologische Studie zur Hebammenkunde am Beispiel der Unruhe. Freiburg/München: Verlag Karl Alber. 2013.
- Figal, Günther: Sokrates. Beck’sche Reihe Denker. 2. Auflage. München 1998
- Platon: Theaitetos. In: Sämtliche Werke, Band 3. Übersetzt von Friedrich Schleiermacher und Friedrich Müller. 35. Auflage. Reinbek bei Hamburg 2007.
- Thomas, Philipp: Leiblichkeit und eigene Natur. In: Böhme, Gernot/Schiemann, Gregor (Hrsg.): Phänomenologie der Natur. Frankfurt/Main: Suhrkamp. 1997.
Linkempfehlungen:
Ihr mögt den WDDD-Podcast und möchtet uns mit einer kleinen Spende unterstützen? Dann könnt ihr das ab sofort via Steady machen:
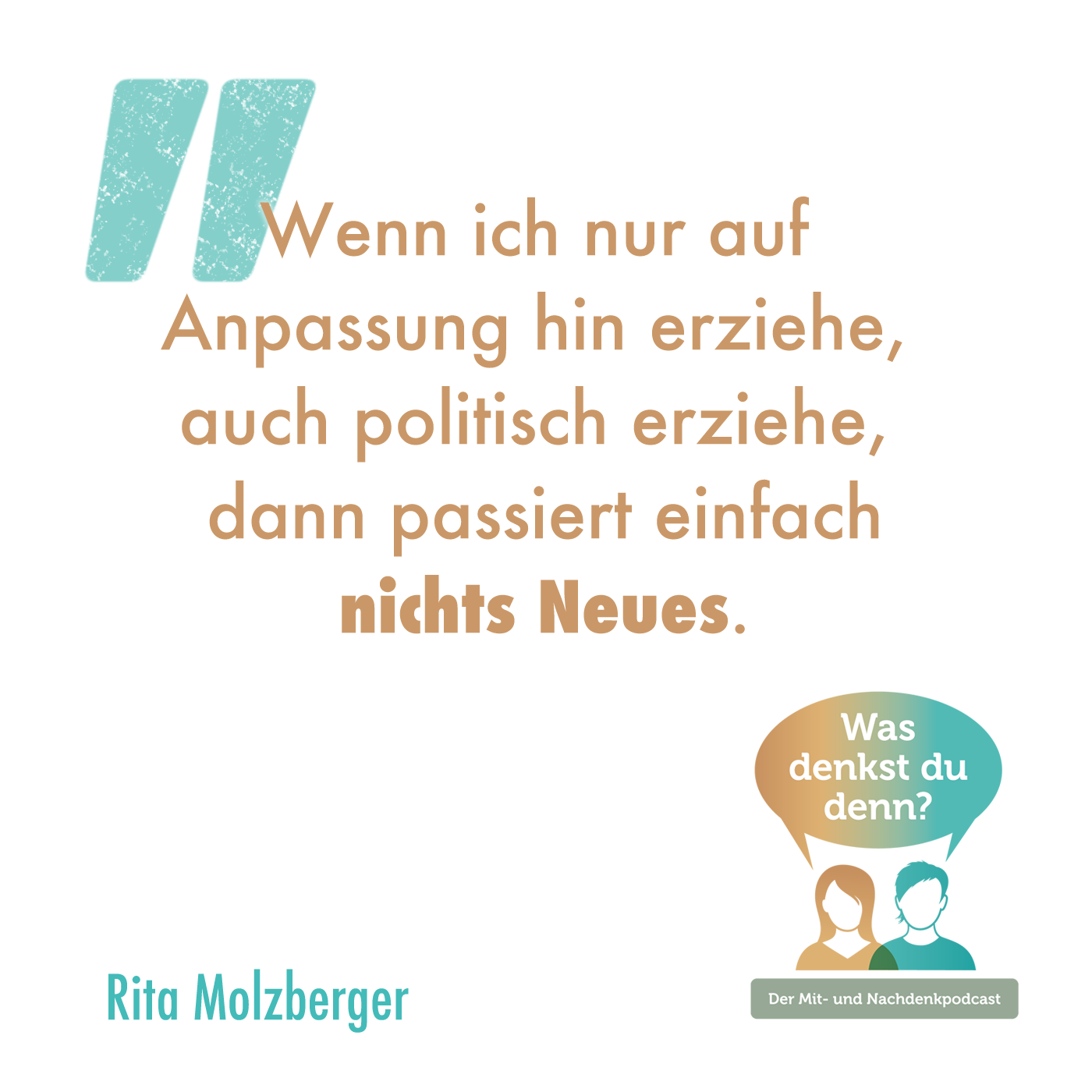
Gibt es eine Pficht zum Widerstand? Das hier ist eine echte Folge 2. Eine Fortsetzung. Denn wir haben uns so lange mit dem Hannah Arendt Zitat: „Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen BEI KANT“ beschäftigt, dass wir die entscheidende Frage gar nicht klären konnten. Wenn es kein Recht zu gehorchen gibt, gibt es dann eine Pflicht zum Widerstand?
Um das zu klären lohnt sich natürlich erst mal zu fragen: Was ist denn Widerstand? Oder besser: Wann ist denn was eigentlich Widerstand? Und reicht nicht auch Widerspruch? Wie viel davon verträgt denn eine Demokratie? Ihr merkt schon, das wird wieder eine bunte Reise durch verschiedene Perspektiven auf das Thema. Beginnend bei der Vita Activa von Hannah Arendt.
Und damit ihr zwischendurch mal kurz spingsen könnt, hier mal die kurze Zusammenfassung der drei Schritte. Vielleicht hilft das beim Hören.
- Stufe: Das Arbeiten -> machen wir, um am Leben zu bleiben und unsere Gattung zu sichern. Für Hannah Arendt geben wir damit eine Antwort auf unsere Sterblichkeit.
- Stufe: Das Herstellen von Gegenständen und Kulturgegenständen -> ist Immortalität. Da spielt die individuelle Sterblichkeit keine Rolle
- Stufe: Das Handeln -> dazu gehört auch das Sprechen. Es ist notwending zum Bilden von politischen Gemeinschaften.
Der Aktivist, der für Datenschutz und damit gegen Teile der AGB von zum Beispiel Facebook kämpft, heißt Max Schrems. Er hat eine NGO gegründet: NOYB – übersetzt: None of your business.
Die Veranstaltungsreihe Köln spricht findet ihr zum Beispiel auf Facebook, Youtube und Twitter. Inzwischen gibt es diese Veranstaltung auch in anderen Städten.
Ritas Literaturliste:
- Bieri, Peter: Wie wollen wir leben? München 2013.
- Hessel, Stéphane: Empört Euch! Berlin 2011.
- Ders., im Gespräch mit Gilles Vanderpooten: Engagiert Euch! Berlin 2011.
- Horster, Detlef: Politik als Pflicht. Studien zur politischen Philosophie. Frankfurt/Main 1993.
- Masschelein, Jan/ Maarten Simons: Globale Immunität oder Eine kleine Kartographie des europäischen Bildungsraumes. Zürich 2005.
- Schmidt, Manfred G.: Demokratietheorien. Eine Einführung. Bonn 2010.
Ihr mögt den WDDD-Podcast und möchtet uns mit einer kleinen Spende unterstützen? Dann könnt ihr das ab sofort via Steady machen:
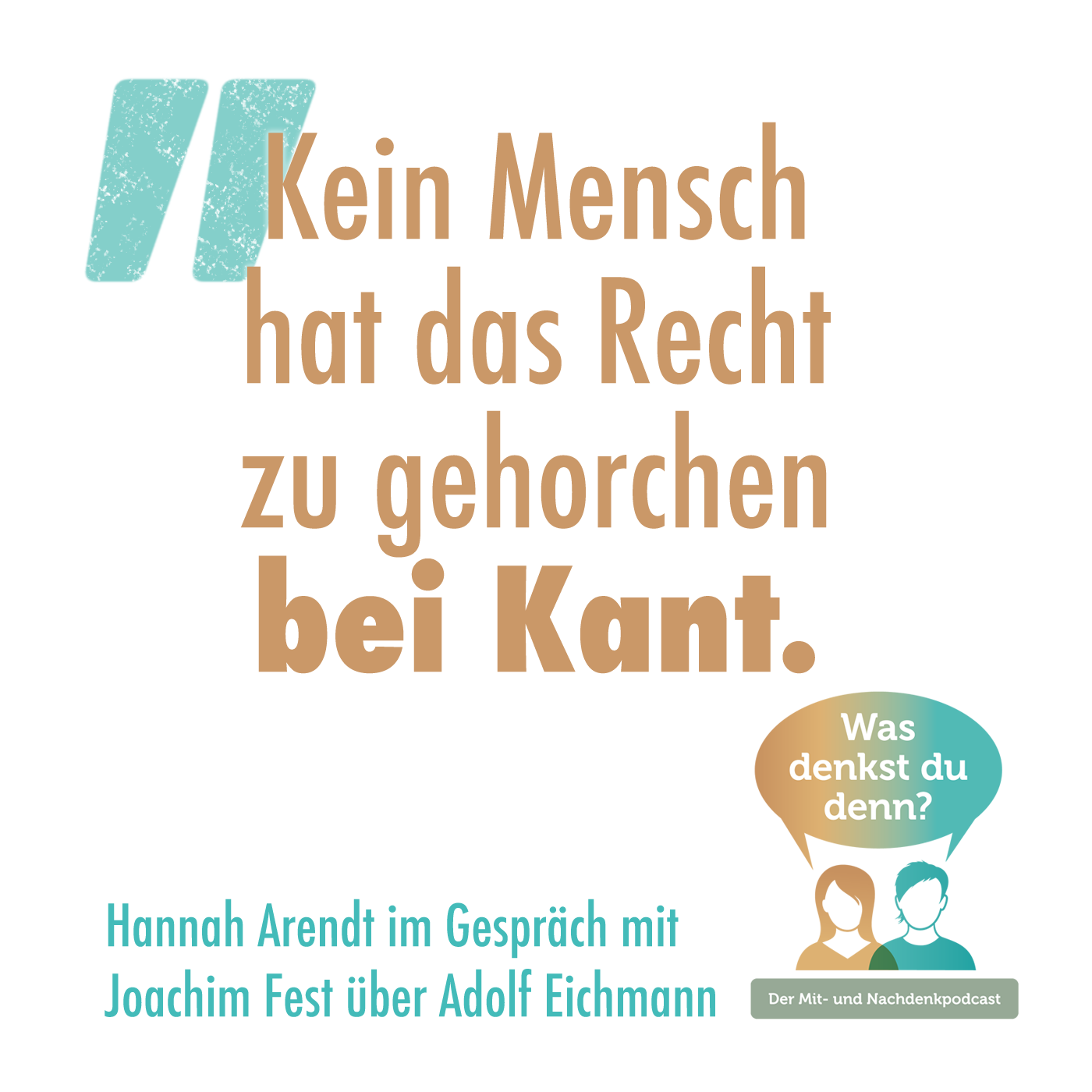
Quellen zum Hannah-Arendt-Zitat:
„Niemand hat das Recht zu gehorchen“ | falschzitate.blogspot.de
Das Zitat beginnt ab ca. 16:20 Minuten
Ritas Literaturliste:
- Adorno, Theodor W.: Theorie der Halbbildung. Frankfurt/Main : Suhrkamp. 2006.
- Arendt, Hannah: Das Urteilen. Texte zu Kants Politischer Philosophie. München : Pieper. 1998.
- Breier, Karl: Hannah Arendt zur Einführung. Hamburg : Junius. 2011.
- Neiman, Susan: Warum erwachsen werden? Eine philosophische Ermutigung. Berlin: Hanser. 2015.
- Rasper, Martin: „No sports“ hat Churchill nie gesagt. Das Buch der falschen Zitate. Salzburg, München: Ecowin. 2017.
- Straßenberger, Grit: Hannah Arendt zur Einführung. Hamburg : Junius. 2015.
Ihr mögt den WDDD-Podcast und möchtet uns mit einer kleinen Spende unterstützen? Dann könnt ihr das ab sofort via Steady machen:
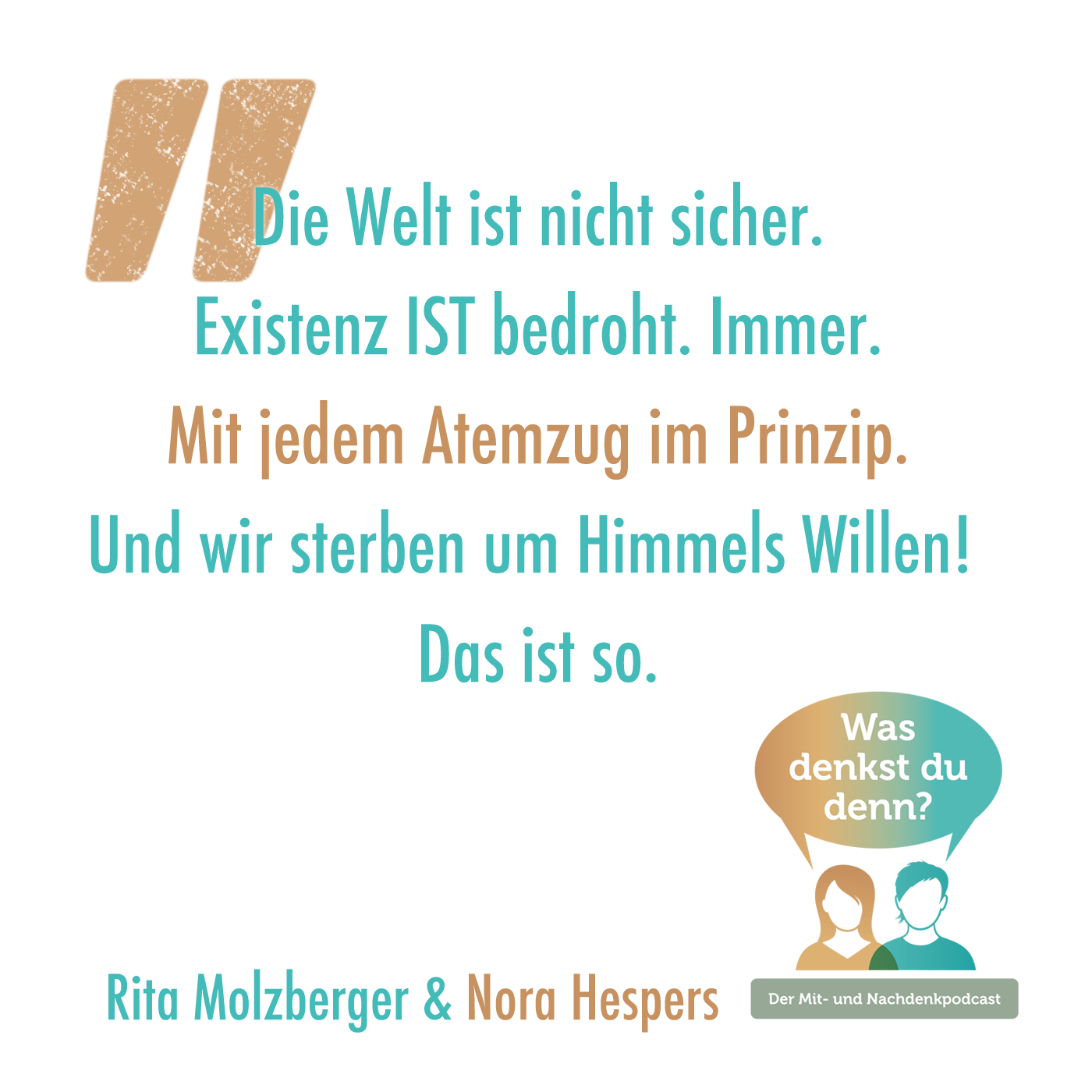
Das ist aber noch kein Grund in Panik zu verfallen. Denn der Sterblichkeit steht ja auch die Geburt gegenüber und das Mensch werden. Trotzdem verändert sich unser Blick auf das Leben, wenn wir uns unserer Sterblickeit bewusst werden. Wenn wir eh alle sterben, warum streben wir dann nach Sinn? Begeben wir uns zum Beispiel in ein Raumschiff und betrachten die Erde aus dem All, ist alles Menschsein zusammengeschrumpft auf einen winzigen blauen Punkt – angeleuchtet von der Sonne. Werden und Vergehen, gut und böse – alles wird eins. Ohne Unterschied.
Wir begeben uns mit euch in unendliche Weiten – und unendliche Tiefen. Auf der Suche nach Antworten auf existentielle Lebensfragen – Aug in Aug mit der Sinnlosigkeit.
Ritas Literaturliste:
- De Beauvoir, Simone: Das andere Geschlecht: Sitte und Sexus der Frau. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt TB. 2000. [Original: Le Deuxième Sexe. 1949.]
- Bollnow, Otto Friedrich: Lebensphilosophie und Existenzphilosophie. Schriften. Studienausgabe in zwölf Bänden, Band 4. Würzburg: Königshausen & Neumann. 2009.
- Camus, Albert: Der Mythos des Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde. In neuer Übersetzung. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt TB. 2000. [Original: Le mythe de Sisyphe. 1942.]
- Fink, Eugen: Der Mensch als Fragment. In: Zur Krisenlage des modernen Menschen. Erziehungswissenschaftliche Vorträge. Würzburg: Königshausen & Neumann. 1989.
- Sartre, Jean-Paul: Der Existenzialismus ist ein Humanismus und andere philosophische Essays 1943 – 1948. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt TB. 2000. [Original: L’existentialisme est un humanisme. 1946.]
- Buber, Martin: Ich und Du. Stuttgart: Reclam. 2008. [Original: 1923.]
Ihr mögt den WDDD-Podcast und möchtet uns mit einer kleinen Spende unterstützen? Dann könnt ihr das ab sofort via Steady machen:
Weitere Links zum Thema:
Der Radiolab Podcast über die Voyager: „Where the sun don’t shine“ (Ab 18’20“)
Die Liebesgeschichte, die auf der Golden Plate mit der Voyager ins All geschickt wurde: „Voyager’s love story„